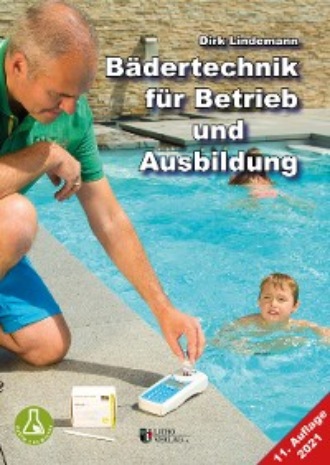
Полная версия
Bädertechnik für Betrieb und Ausbildung
10.5.1 Wirkungsweise ..................................179
10.5.2 Pulverkohledosierung .........................179
10.5.3 Anforderungen an die Pulver-Aktiv-kohle (nach DIN 19603) ......................179
10.6 Flockung ...........................................181
10.6.1 Bedeutung der Flockung ....................181
10.7 Filtrationen .......................................184
10.7.1 Filterbare Stoffe: .................................184
10.7.2 Filtrationsvorgänge und Filtermateri-alien ....................................................184
10.7.3 Filterarten ..........................................186
10.7.3.1 Festbettfilter ....................................186
10.7.3.1.1 Offene Einschichtfilter ...................186
10.7.3.1.2 Geschlossene, Einschichtfilter......186
10.7.3.1.3 Eliminierung von Desinfekti-onsnebenprodukten Adsorption durch Mehrschichtfiltration............189
10.7.3.1.4 Wartung der Ein- und Mehr-schichtfilter....................................190
10.7.3.1.5 Adsorption an Korn-Aktivkohle .....194
10.7.3.1.6 Probleme bei der Filtration ...........196
10.7.3.1.7 Aufbereitung von aktivkohlehalti-gem Schlammwasser ...................200
10.7.3.1.8 Spülluftgebläse .............................201
10.7.3.2 Anschwemmfilter ............................203
10.7.3.2.1 Geschlossene Anschwemmfilter...203
10.7.3.2.2 Offene Anschwemmfilter ...............206
10.7.3.3 Quarzsand-Niederdruckfilter (In DIN 19643 nicht behandelt) ....................208
10.7.3.4 Unterdruckfilter ...............................209
10.8 pH-Wert-Einstellung .........................211
10.8.1 Allgemeines: ......................................211
10.8.2 Mittel zur pH-Korrektur (DIN 19643) .......211
10.8.3 pH-Regelung mit Kohlenstoffdioxid nach DIN EN 15513 ............................212
10.8.3.1 Grundlagen1) ..................................212
10.8.3.2 CO2-Dosiertechnik ..........................212
10.8.4 pH-Einstellung durch Säureabbau .....212
10.9 Desinfektionsanlagen für Schwimm- und Badebecken-wasser ...............................................214
10.9.1 Allgemeines ........................................214
10.9.2 Desinfektionsmittel .............................215
10.9.3 Chlorungsverfahren ............................215
10.9.3.1 Leistungsvolumen der Chlor- Do-sieranlagen .....................................215
10.9.3.2 Chlorgasverfahren ..........................215
10.9.3.2.1 Desinfektionsanlagen mit Chlor-gas nach DIN EN 15363 ...............215
10.9.3.2.2 Umgang mit Chlorgasanlagen ......222
10.9.3.2.3 Chlorgaswarngerät .......................224
10.9.3.2.4 Räume für die Chlorgaslagerung..225
10.9.3.2.5 Verhalten bei unkontrolliertem Chlorgasaustritt ............................226
10.9.3.3 Desinfektionsanlagen mit Chlor-gas elektrolytisch hergestellt am Verwendungsort ..............................227
10.9.3.4 Chlor-Elektrolyseanlagen im Inline-Betrieb (Durchfluss-Chlor-Elektrolyse) .....................................229
10.9.3.5 Desinfektion mit Natriumhypochlorit - Lösung (n. DIN EN 1577) .................230
10.9.3.6 Desinfektionsanlagen mit Natrium-hypochlorit-Lösung, hergestellt am Verwendungsort (Chlorelektrolyse) .230
10.9.3.7 Desinfektion mit Calciumhypochlo-rit .....................................................233
10.9.3.7.1 Dosieranlagen für Calciumhypo-chlorit ............................................233
10.9.3.7.2 Calciumhypochlorit-Verfahren mit Entsedimentierung........................234
10.9.4 Sonstige Desinfektionsverfahren (In DIN 19643 nicht behandelt) ................237
10.9.4.1 Chlor-Chlordioxid-Anlage ................237
10.9.4.2 Dosierung von organischem Chlor (Trichlorisocianursäure) ..................238
10.9.4.3 Ozon-Bromid-Verfahren ..................239
Inhalt

8
10.9.4.4 UV-Bestrahlungensgeräte und UV-Anlagen für Schwimm- und Badebecken ....................................240
10.9.5 Ozonanlagen ......................................242
10.9.5.1 Eigenschaften des Ozons ...............242
10.9.5.2 Einsatz des Ozons im Schwimm-badbereich ......................................242
10.9.5.3 Ozonverfahren ................................242
10.9.5.3.1 Flockungsfiltration bei der Ver-fahrenskombination „Flockung-Filtration-Ozonung-Sorptionsfilt-ration-Chlorung“ gilt: .....................243
10.9.5.3.2 Sorptionsfiltration bei der Ver-fahrenskombination „Flockung-Filtration-Ozonung-Sorptionsfilt-ration-Chlorung“............................245
10.9.5.3.3 Mehrschichtfiltration bei der Ver-fahrenskombination Flockung-Ozonung-Mehrschichtfiltration mit Sorptionswirkung-Chlorung“ ...247
10.9.5.3.4 Prüfung der Flockungsfiltration und der Sorptionsfiltration.............249
10.9.5.3.5 Chlorung .......................................249
10.9.5.3.6 Ozonerzeugung ............................250
10.9.5.3.7 Anforderung an Ozonanlagen ......250
10.9.5.3.8 Unfallverhütungsregeln zur Ver-wendung von Ozon.......................251
10.9.6 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser mit der Verfah-renskombination „Ultrafiltration! .........253
10.9.6.1 Beschreibung des Verfahrens .........253
10.9.6.2 Verfahrensstufen .............................253
10.9.6.3 Eliminierung von Desinfektionsne-benprodukten ..................................254
10.9.6.4 Anlagenaufbau und Betrieb ............254
10.9.6.5 Betrieb von UF-Anlagen .................256
11 Bauliche Durchbildungen der Hallen- und Freibäder ...............259
11.1 Technische Grundlagen ..................259
11.1.1 Baustoffe und Werkstoffe im Bäder-bereich ..............................................259
11.1.1.1 Einteilung der Werkstoffe ................259
11.1.1.2 Wichtige Metalle .............................259
11.1.2 Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmit-tel für Wartung und Reparatur ............264
11.1.2.1 Werkzeuge ......................................264
11.1.2.2 Maschinen zur Wartung der Anlagen 266
11.1.2.2.1 Handmaschinen und Geräte.........266
11.1.2.2.2 Stationäre Maschinen ...................267
11.1.2.2.3 Schweißmaschinen ......................268
11.1.3 Verbindungen (Fügen) .......................269
11.1.3.1 Lösbare Verbindungen ....................269
11.1.3.2 Unlösbare Verbindungen ................271
11.2 Konstruktion und Ausbildung wichtiger Bauteile ............................273
11.2.1 Allgemeine sicherheitstechnische .....Anforderungen an die Anlagen ..........273
11.2.2 Konstruktion wichtiger Bauteile ..........273
11.2.2.1 Tragende Konstruktionsteile ...........273
11.2.2.2 Wände und Decken ........................274
11.2.2.3 Belichtungsflächen ..........................274
11.2.2.4 Dachflächen ....................................274
11.2.2.5 Bodenbeläge ...................................274
11.2.2.6 Dehnfugen ......................................275
11.2.2.7 Absperrung gegen Feuchtigkeit1) ...........275
11.2.2.8 Potentialausgleich ...........................276
11.2.3 Beckenanlagen ..................................276
11.2.3.1 Stahlbeton-, Spannbetonbecken ....276
11.2.3.2 Becken aus Edelstahl ....................276
11.2.3.3 Aluminiumbecken ...........................279
11.2.3.4 Becken aus Kunststoffen ................279
11.2.3.5 Beckenauskleidungen .....................281
12 Installationsanlagen ..................282
12.1 Schließ- und Kassenanlagen ..........282
12.1.1 Schlosskonstruktionen .......................282
12.1.1.1 Einfache Schlösser .........................282
12.1.1.2 Chubbschlösser ..............................282
12.1.1.3 Zylinderschlösser ............................282
12.1.2 Beschaffenheit von Schlössern und Türen nach (GUV 18.14) ...................283
12.1.3 Spezialschlösser im Bäderbetrieb ......283
12.1.3.1 Einfaches Bäderschrankschloss .....283
12.1.3.2 Pfand- oder Kassierschloss ............284
12.1.3.3 Kartenschloss (Billett-Depot-Schloss) ..........................................284
12.1.3.4 Elektronische Schlösser .................284
12.1.4 Schlüssel- und Schlossanlagen .........285
12.1.5 Wartung der Schlösser .......................286
12.1.6 Kassenanlagen ..................................286
12.2 Elektroinstallationsanlagen ............289
12.2.1 Grundlagen der Elektrotechnik ...........289
12.2.1.1 Der Strom im Leiter .........................289
12.2.1.2 Wirkungen des Stromes .................289
12.2.1.3 Der elektrische Strom fließt ............290

Inhalt
9
12.2.1.4 Formen der Spannungserzeugung .291
12.2.1.5 Größen der Elektrotechnik ..............292
12.2.1.6 Stromarten .....................................293
12.2.1.7 Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung ............293
12.2.2 Stromversorgung der Bäderbetriebe ..295
12.2.2.1 Leistungsbedarf ..............................295
12.2.2.2 Niederspannungsversorgung ..........296
12.2.2.3 Mittelspannungsversorgung ............296
12.2.2.4 Stromkreise im Bad ........................297
12.2.3 Aufbau und Wartung elektrischer Anlagen ..............................................297
12.2.3.1 Wartung der Schalt- und Verteiler-stationen .........................................297
12.2.3.2 Notstrom- und Ersatzstromanlagen 298
12.2.3.3 Motoren ...........................................299
12.2.3.4 Beleuchtungsanlagen .....................300
12.2.3.5 Anlagen mit Schwachstrom ............303
12.3 Sanitärinstallationen ........................304
12.3.1 Leitungsanlagen für Trink- und Be-triebswasser .......................................304
12.3.1.1 Stahlrohre .......................................304
12.3.1.2 Kupferrohre .....................................305
12.3.1.3 Gussrohre .......................................305
12.3.1.4 Faserzementrohre ..........................305
12.3.1.5 Kunststoffrohre ...............................305
12.3.1.6 Rohrverbindungen ..........................306
12.3.1.6.1 Lösbare Verbindungen .................306
12.3.1.6.2 Unlösbare Verbindung ..................306
12.3.1.7 Ausgleichsrohre ..............................307
12.3.1.8 Armaturen .......................................307
12.3.2 Entwässerungsanlagen ......................309
12.3.2.1 Leitungsanlagen .............................309
12.3.2.2 Einbauteile ......................................310
12.3.3 Entwässerung tiefliegender Räume Schutz gegen Rückstau .....................311
12.3.4 Korrosionsprobleme bei Installati-onsanlagen .........................................312
12.3.4.1 Chemische Korrosion .....................312
12.3.4.2 Elektrochemische Korrosion ...........312
12.3.4.3 Spezielle Formen der Korrosion .......313
12.3.4.3.1 Interkristalline Korrosion ..............313
12.3.4.3.2 Korrosion in Kaltwasserleitungen .313
12.3.4.3.3 Korrosion in Warmwasserbehäl- .tern und Warmwasserleitungen ....315
12.3.4.4 Steinbildung ....................................316
12.3.4.5 Korrosion in Dampfheizungsanlagen 317
12.3.4.6 Korrosion von Heizölbehältern ........317
12.3.4.7 Korrosion durch Abgase .................317
12.3.4.8 Korrosion durch Schwimmbecken-wasseraufbereitung ........................318
12.4 Heizungs- und Lüftungsanlagen ....319
12.4.1 Grundlagen der Wärmelehre ..............319
12.4.1.1 Entstehung der Wärme ...................319
12.4.1.2 Temperatur ......................................319
12.4.1.3 Wärmefortpflanzung .......................319
12.4.1.4 Wärmemenge .................................320
12.4.2 Heizungssysteme ...............................320
12.4.2.1 Zentralheizungen ............................320
12.4.2.2 Kesselarten .....................................320
12.4.2.3 Heizungssysteme, die nach der Wärmeabgabe unterschieden wer-den ..................................................321
12.4.2.4 Rohrführungssysteme .....................321
12.4.2.4.1 Rohrleitungen ...............................321
12.4.2.5 Verteilungen ....................................322
12.4.3 Warm- und Heißwasserheizungen .....322
12.4.3.1 Grundlagen .....................................322
12.4.3.2 Offene Anlagen ...............................323
12.4.3.3 Geschlossene Warm- und Heiß-wasser-Anlagen .............................323
12.4.4 Heizungsanlagen für den Badebe-trieb ....................................................327
12.4.4.1 Warmwasserbereitungsanlagen .....328
12.4.4.1.1 Einzelbereitung für kleinere Was-sermengen....................................328
12.4.4.1.2 Zentrale Warmwasserbereitung ...329
12.4.4.1.3 Warmwasserbereiter für das Schwimm- und Badewasser .........329
12.4.4.1.4 Beckenwassererwärmung im Sprühverfahren .............................331
12.4.4.2 Solarheizungen ..............................332
12.4.5 Dampfheizungen ...............................334
12.4.5.1 Grundlagen .....................................334
12.4.5.2 Arten der Dampfheizungen .............334
12.4.5.3 Niederdruckdampfheizung ..............334
12.4.6 Fernwärmeversorgung .......................335
12.4.6.1 Heizkraftwerk ..................................335
12.4.6.2 Blockheizkraftwerke (BHKW) ..........335
12.4.6.3 Fernwärmeanschluss des Bades ....336
12.4.6.4 Technische Bestimmungen für die Fernwärmeübergabe ......................336
12.4.7 Luftheizungen und Klimaanlagen .......337
12.4.7.1 Luft als Wärmeträger ......................337
12.4.7.2 Luftheizungen .................................339
12.4.7.3 Lufterneuerungsanlagen .................339
Inhalt

10
12.4.7.3.1 Behaglichkeit in der Schwimm-halle ..............................................339
12.4.7.3.2 Richtwerte für Schwimmhallen .....340
12.4.7.3.3 Regulierung der Raumluft.............340
12.4.7.4 Lüftungs- und Klimaanlagen ...........342
12.4.7.4.1 Lüftungsarten................................342
12.4.7.4.2 Klimaanlagen ................................342
12.4.7.5 Regelungsgrundsätze nach KOK ...343
12.4.7.6 Umweltbewusster Umgang mit der Energie ...........................................344
12.4.7.6.1 Schwimmbeckenabdeckungen .....345
12.4.7.6.2 Wärmerückgewinnungseinrich-tungen...........................................346
12.4.7.6.3 Wärmerückgewinnung aus der Abluft ............................................348
12.4.7.6.4 Wärmerückgewinnung aus Ab-wasser ..........................................350
Literaturverzeichnis ............................354
Technische Beschreibungen und Informationen der Firmen und Personen: ...........................355
Index ...................................................356
11


Bädergestaltung Planen und Einrichten der Bäder
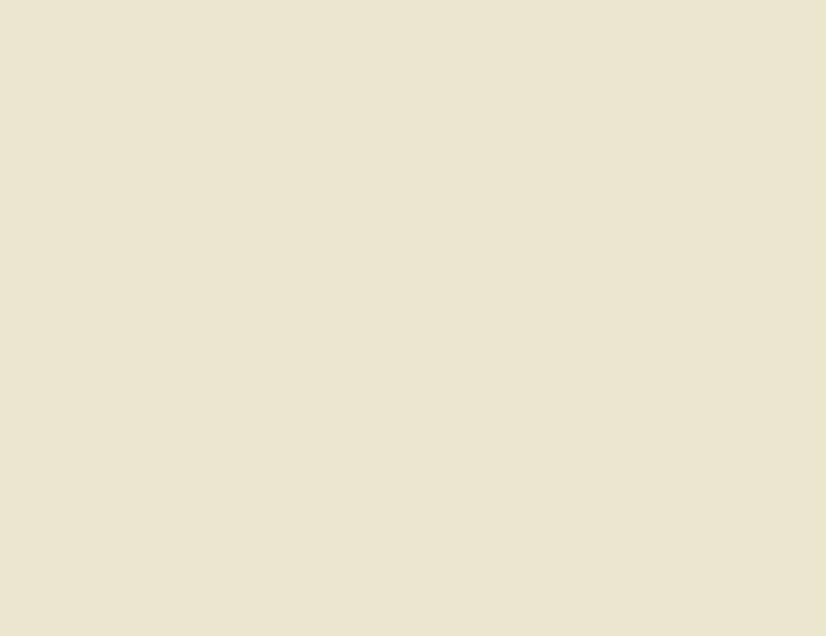
Bädergestaltung
Planen und Einrichten der Bäder
Das Badewesen, und besonders der öffentli-che Bäderbereich, hatten ihren Ursprung in der Erhaltung der Volksgesundheit. Heute werden die Bäder immer mehr zu Einrichtungen für den Erhalt der Fitness und der aktiven Freizeitgestal-tung.
Die fortschreitende Industrialisierung und die damit verbundene Umweltbelastung machen wieder Anlagen erforderlich, die der Gesundheit der Menschen förderlich sind. Da das Wasser als eine Quelle der Gesundheit anzusehen ist, bleibt es die Aufgabe der Bäder, die zum Teil verloren-gegangene Heilkraft natürlicher Bäder zu erset-zen und die Möglichkeit sportlicher Betätigung und Erholung zu bieten. Schon seit den siebzi-
ger Jahren wurde ein Trend vom Badegewässer über die Frei- und Hallenbäder alter Prägung zu freizeitorientierten Bädern feststellbar.
Dies erkannten nicht nur die Städte und Gemein-den, sondern auch Privatgesellschaften, so dass vermehrt der Bau eines Bädertyps zu beobach-ten ist, der aus der Kombination konventioneller Bäder mit überwiegenden freizeitorientierten Anlagen und deren vielfältigem Nutzungsange-bot besteht.
Verbände und Fachleute auf dem Gebiet des Bäderbaus und des Bäderbetriebs verfassten entsprechende Richtlinien, die zum Teil Geset-zeskraft erhielten und beim Neubau und Ausbau von Bäderanlagen Berücksichtigung finden.
Wichtige Normen, Richtlinien und Regeln für die Planung und Gestaltung von Bädern
Raumordnungs- und Planungsgesetze
Baugesetzbuch und Bauordnungen der Länder und Kommunen
Normen und Richtlinien für Schwimmbadanlagen 3.1 Richtlinien für den Bäderbau (KOK-Richtlinien); Herausgeber: Koordinierungskreis Bäder, 1996 3.2 Sicherheitstechnische Anfor-derungen an Planung und Bau (EN 15288 Teil1) 3.3 Sicherheitstechnische Anforderungen an den Betrieb (EN 15288 Teil2) 3.4 Sicherheitstechnische Anforderungen an Schwimmbadgerä-te: Schwimmsportgeräte, Wasserrutschen, Schwimmbadgeräte (Teile 1-11)
DIN 19643 - Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser, Teile 1, 2, 3 und 4; Chlor-gasdosieranlagen (DIN 19606); Ozonerzeugungsanlagen (DIN 19627)
Gesetzliche Grundlage zur Sicherung und Überwachung der Qualität des Schwimm- und Ba-debeckenwassers: „Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutz-Gesetz - IfSG)”.
Europäische Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Paralaments und des Rates der Europä-ischen Union über die Qualität und Bewirtschaftung der Badegewässer.
FINA-Regeln (Internationale Schwimmsportrichtlinien der „Federation International de Natati-on de Amateur“) und DSV-Wettkampfbestimmungen (Deutscher Schwimmverband)
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und Unfallverhütungsrichtlinien (UVR) der „Bundesar-beitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der Öffentlichen Hand“ (BAGUV)
Sicherheitsregeln für Bäder: GUV-R 1/111 (bisher GUV 18.14)
VDI-Richtlinie: VDI 2089 Blatt 1 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Hal-lenbäder
DIN-Bestimmungen, Normblätter und Richtlinien des „DIN Deutschen Institut für Normung e.V.“; Normenausschuss Sport- und Freizeitgeräte
Merk- und Informationsblätter von den „Technischen Ausschüssen“ der „Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V.“ und dem „Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.“
12


Planen und Einrichten der Bäder Bädergestaltung
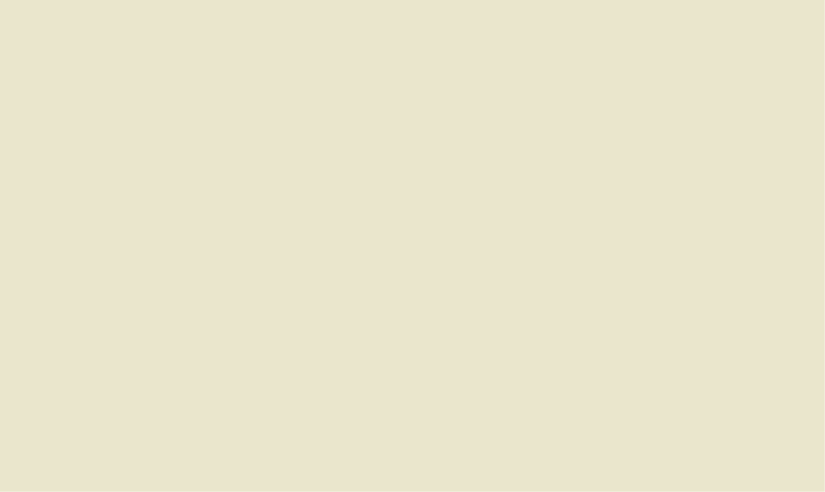
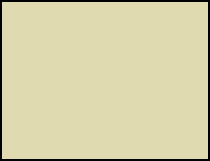
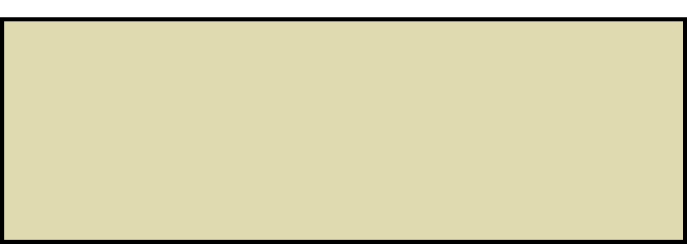
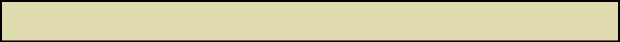
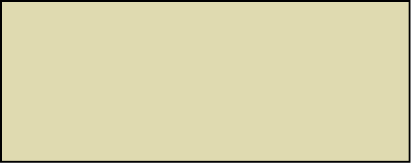
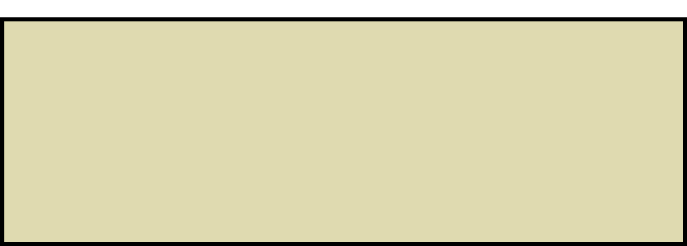
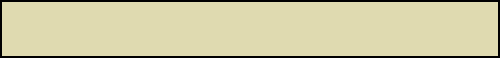
Sachverständige aus Wissenschaft, Industrie, Planung,
Aufsichtsbehörden, Hygieneinstitute und Bäderbetrieben
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.
Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.
Deutscher Sportbund (DSB)
Deutscher Schwimmverband (DSV)
Koordinierungskreis
Bäder
Richtlinien für den
Bäderbau
(KOK-Richtlinie)
DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser



