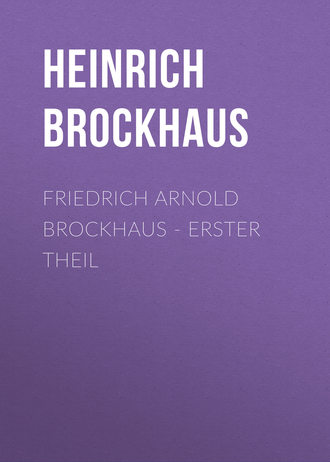
Полная версия
Friedrich Arnold Brockhaus – Erster Theil
Ist also dieser Küster ohne consens und collation des Klosters erwählt, es ist auch bei der Wahl Niemand vom Rathhause zugegen gewesen; auch über 1½ Jahr von mir allein in Gegenwart des Lehnherrn auf dem Chor eingeführt und ist kein Vogt dabei gewesen.
Endlich hat der Pastor Melchior auch einen geheimnißvollen Vorfall verzeichnet, ohne hinzuzufügen, was er selbst davon halte:
1757, den 7. October, hat sich des Abends um 7 Uhr Folgendes in unserer Kirche zugetragen.
Wie die Fräuleins des Klosters Welver um bemerkte Zeit in ihre Kirche gehen wollten, sehen sie, daß es in unserer Kirche helle ist.
Wie sie nun vermuthen, es möchten Diebe in der Kirche sein, müssen nicht nur alle Bediente des Klosters, sondern auch die Leute, so zu Welver am Kirchhofe wohnen, unsere Kirche besetzen. Die auch sämmtlich das Licht in unsrer Kirche gesehen.
Wie nun der Küster gezwungen wird, die Kirche zu öffnen, ist das Licht auf einmal verschwunden. Die Leute sind durch die ganze Kirche gegangen, ob etwas darin wäre, haben aber nichts verspürt. Ob nun dieses eine Vorgeschichte ist, ob und wann es soll erfüllt werden, wird die Zeit lehren; Gott wende Alles zum Besten.
Einige nähere Lebensumstände dieses Mannes, des Großvaters von Friedrich Arnold Brockhaus und jedenfalls des hervorragendsten unter dessen Vorfahren, sind durch ein altes Buch erhalten, in das er außer seinen Ausgaben (aus deren Verzeichnung hervorgeht, daß er auch ein tüchtiger Oekonom und guter Haushalter war) dann und wann Nachrichten über seine Erlebnisse einschrieb.6
Pastor Melchior verzeichnet darin zunächst den Tag seiner Geburt und Taufe und macht bei Nennung eines seiner Pathen, einer adelichen Dame, die Bemerkung: »welche aber nach der Zeit zum pabtum abgefallen und ihren eigenen Taufbund gebrochen«. Dann fährt er fort:
Gott gebe, daß mein nahme im Himmel unter der Zahl der außerwehlten auch möge angeschrieben stehen. Habe Dank, Du frommer Gott, daß Du mich wunderbarlich im mutterleibe gebildet, mit einer vernünftigen Seele und gesunden Gliedmaßen von frommen Eltern hast lassen gebohren werden und sonderlich in der heiligen Taufe einen ewigen Bund mit mir gemacht. Gib gnade, mein Gott, daß ich in diesem Bunde leben, leyden und sterben möge.
Darauf erwähnt er seiner Studienzeit. Er ging im Februar 1724 (also 18 Jahre alt) nach Halle, aber schon am 6. Juli dieses Jahres nach Jena: »weil mir die collegia theologica in Halle nicht anstehen wollten«; von da reiste er am 2. August 1726 nach Leipzig und kam am 20. August 1727 über Frankfurt a. M., Köln und Altena (wo er einmal predigte, wahrscheinlich weil diese Stadt der Geburtsort seines inzwischen als Pastor in Soest verstorbenen Vaters war und dort noch Verwandte von ihm lebten) nach Hause zurück. Er machte sein Examen und predigte mehrmals, bezog indeß im Sommer 1728 nochmals die Universität Halle »wegen des königlichen Befehls, daß niemand sollte befördert werden, der nicht zuletzt in Halle studirt«. Am 28. August 1728 wieder in Soest angelangt, wurde er am 1. December zum Prediger nach Meyerich berufen, am 8. examinirt, am 9. ordinirt und am 12. December installirt.
Ueber seine Studienzeit schreibt er folgende Selbstanklage nieder, die indeß gleich der folgenden wol nicht ganz wörtlich zu nehmen ist:
Wie ich nun mein Universitätsleben zugebracht, ist dem allwissenden Gott am besten bekannt. Viel gutes habe ich daselbst gelernt, aber auch durch Müßiggang, Verschwendung und auf andere Gott allein bewußte Weise mich schwerlich versündiget.
Ach Gott, wenn mir das kömmet ein, Was ich mein Tage u. s. w.Dann fährt er fort, nach Erwähnung seiner Anstellung:
Ob es mir nun gleich an genugsamer geschicklichkeit fehlet, ich auch leyder sonderlich im Anfang meines ambtes Vieles versehen und also Blutschulden auf meine arme Seele geladen (!), so verspreche ich doch inskünftige zu verbessern, was ich bißanhero versehen habe, und glaube festiglich, daß mein getreuer Erlöser Jesus Christus mit seinem theuern Blut meine Blutschulden tilgen werde.
Die übrigen Notizen des Tagebuchs beziehen sich meist auf Ereignisse in seiner Familie. Er war dreimal verheirathet und hatte funfzehn Kinder (sechs Söhne und neun Töchter), von denen neun noch vor ihm starben, meist in sehr zartem Alter. Seine erste Frau starb im ersten Wochenbett und zwar, wie er bemerkt: »an eben dem Tage und in eben der Stunde, darinnen wir vorm Jahre waren copuliret; so war sie auch an eben demselben Tage vor 25 Jahren gebohren«; er fügt hinzu: »Gott gebe allen frommen Christen eine solche dreifach glückselige Stunde!« Mit seiner zweiten Frau, Maria Elisabeth, Tochter des Pastors Hennecke in Soest, war er fast zwanzig Jahre verheirathet und sie wurde die Mutter von zehn Kindern, darunter die beiden Söhne, die seinen Namen fortpflanzten. Zum dritten male verheirathete er sich in seinem funfzigsten Jahre mit Klara Dorothea Quante und lebte mit ihr ebenfalls fast zwanzig Jahre, bis an seinen Tod (1775), während seine Witwe, die ihm vier Kinder geboren hatte, erst 1808, 83 Jahre alt, starb.
Noch einige Aeußerungen des Pastors Melchior in seinem Tagebuche seien zu seiner Charakterisirung hier verzeichnet.
Beim Verlust eines dreijährigen Töchterchens schreibt er:
Mein halbes Herz ist mit ihr in die Erde gescharrt. Gott gebe, daß wir in kurzer Zeit im Himmel uns mögen wiedersehen.
Amen, Amen, komm du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange, Deiner warte ich mit Verlangen.Und bei einem ähnlichen Verluste:
Der Herr bescheere mir ein baldiges freudiges Wiedersehen dieses und meiner übrigen in der Herrlichkeit triumphirenden Kinder, nach seinem gnädigen Willen. Dulce meum terra tegit. Ich habe hier wenig guter Tag u. s. w.
Kaum 30 Jahre alt, wurde er von heftigen Leiden am Fuße heimgesucht; diese verloren sich nach einigen Jahren und er erreichte dann das Alter von 70 Jahren. Während seiner Leiden schreibt er einmal:
Doch ich will schweigen und meinen Mund nicht aufthun, der Herr wirds wohl machen! Ich werde doch gewiß endlich, wo nicht in dieser Zeit doch gewiß in der ewigkeit zu Gottes größe sagen: der Herr hat alles wohl gemacht!
Und nach seiner Genesung schreibt er:
Gelobet sei der Herr täglich, Er leget uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.
Der unmittelbare Amtsnachfolger dieses ersten Pastors in Meyerich war sein zweiter Sohn Ludolph Wolrath (oder Wohlrath) Arnold Brockhaus, geb. am 6. September 1744, eine Zeit lang Lehrer am Gymnasium zu Soest, zum Pastor in Meyerich erwählt am 26. December 1775, also kaum sechs Wochen nach dem Tode seines Vaters. Er trat sein Amt 1776 am Sonntage Sexagesimä (11. Februar) an und bekleidete es 46 Jahre lang, bis 1822, wo er es, 78 Jahre alt, wegen Altersschwäche niederlegte; er starb am 6. Februar 1823.
Diese beiden Pastoren, Vater und Sohn, haben also zusammen fast ein volles Jahrhundert (93 Jahre lang) derselben Gemeinde vorgestanden. Sie sind auch Beide in der kleinen Kirche zu Welver beerdigt, wo ihre Grabstätten durch Leichensteine bezeichnet sind. Zu ihrem Gedächtniß hat Heinrich Brockhaus (der zweite Sohn von Friedrich Arnold) im Jahre 1869 der Kirche zu Welver ein von Professor Andreae in Dresden gemaltes Altarbild geschenkt.
Der zweite Pastor zu Meyerich, Ludolph Wolrath Arnold Brockhaus, hatte zwei Söhne, die sich beide gleichfalls dem geistlichen Berufe widmeten und zwar nicht in Meyerich, aber in andern westfälischen Gemeinden angestellt wurden: Ludolph Brockhaus, geb. am 28. September 1778, Pastor in Lüdenscheid, und Theodor Brockhaus, geb. am 18. Mai 1780, Pastor in Kierspe; Söhne und Enkel von ihnen wirken noch jetzt als Pastoren in westfälischen Gemeinden.
Ein zweiter Sohn des ersten Pastors zu Meyerich, der ältere Bruder des zweiten Pastors (die übrigen vier Söhne waren noch als Kinder gestorben) wurde der Stammvater des nicht-theologischen, kaufmännischen und buchhändlerischen Zweigs der Familie Brockhaus. Es war dies der Vater von Friedrich Arnold Brockhaus, Johann Adolf Heinrich (oder Henrich) Brockhaus, geb. zu Meyerich am 21. Mai 1739. Derselbe erlernte die Handlung in Hamm und zog dann nach der damals Freien Reichsstadt Dortmund, wo er 1767 Katharina Elisabeth Davidis (geb. am 22. März 1736), Witwe des Dr. med. Kirchhoff, heirathete und ein Materialwaarengeschäft begründete. Er war Mitglied des Raths und überhaupt in seiner Vaterstadt angesehen, wo er am 26. März 1811 starb.
Johann Adolf Heinrich Brockhaus hatte zwei Söhne, die er für seinen Beruf, den kaufmännischen, bestimmte.
Der ältere, Gottlieb Brockhaus, geb. am 4. September 1768, übernahm das väterliche Geschäft und blieb bis an sein Lebensende (30. Mai 1828) in Dortmund.
Der jüngere Sohn war Friedrich Arnold Brockhaus, dessen Leben und Wirken die nachfolgenden Blätter gewidmet sind.
2.
Jugendzeit und erstes Mannesalter
Friedrich Arnold Brockhaus wurde zu Dortmund am 4. Mai 1772 geboren. Nach dem Kirchenbuche der evangelischen Sanct-Reinoldi-Kirche daselbst (bei welcher sein Vater das Amt eines Diakonen bekleidete) erhielt er in der am 8. Mai im Hause des Predigers Mellmann vollzogenen Taufe die Namen David Arnold Friederich, doch scheint er den erstern Vornamen nie geführt zu haben und die beiden andern gebrauchte er in umgekehrter Reihenfolge; sein Rufname war Arnold. Taufzeugen waren: David Friedrich Davidis, Subdelegatus und Pastor zu Wennigern (wahrscheinlich der Bruder seiner Mutter), Ludolph Wolrath Arnold Brockhaus, Lector an dem Gymnasium zu Soest (der spätere Pastor zu Meyerich, ein jüngerer Bruder seines Vaters) und Jungfrau Maria Elisabeth Davidis (vermuthlich eine Schwester seiner Mutter).
Seine Jugendzeit verlebte er in Dortmund. Für den Kaufmannsstand, zu dem ihn sein Vater bestimmt hatte, zeigte er anfangs keine besondere Neigung, dagegen von frühester Jugend an das lebhafteste Interesse für die Literatur. Sein Vater suchte diese Neigung auf alle Art zu unterdrücken und stellte ihn deshalb, während er ihn das dortige Gymnasium besuchen ließ, in den Freistunden in seinem Verkaufsladen mit an. Mit 16 Jahren, 1788, gab er ihn nach Düsseldorf in die Lehre zu einem Kaufmanne Namens Friedrich Hoffmann, bei dem er die »Handlung« erlernen sollte. Dieser Aufenthalt dauerte fünf bis sechs Jahre und wurde von dem jungen Manne gut benutzt, sodaß ihn sein Principal trotz seiner Jugend bald zu größern Handlungsreisen verwendete und ihm nach und nach die wichtigsten Arbeiten übertrug. Derselbe scheint selbst die Absicht gehabt zu haben, ihn zu seinem Compagnon zu machen, und mit seiner Nichte, Maria Siebel, zu verheirathen; doch kam es zu einem Zerwürfniß zwischen Principal und Gehülfen, und Brockhaus verließ infolge dessen seine Stellung in Düsseldorf.
Mit 21 Jahren, 1793, ins älterliche Haus nach Dortmund zurückgekehrt, wo inzwischen (am 15. August 1789) seine von ihm stets hochverehrte Mutter gestorben war, wurde er vom Vater wieder in dessen Materialwaarenhandlung beschäftigt, fand aber an dem Verkehr mit den nach der Stadt kommenden Bauern, dem Abwiegen von Kaffee und Zucker begreiflicherweise jetzt noch weniger Gefallen als früher. Er hatte auf seinen Geschäftsreisen weitere Gesichtspunkte erhalten, die ihm die kleinbürgerlichen Verhältnisse seiner Vaterstadt und das Detailgeschäft seines Vaters verleideten; er fühlte, daß ihm für seinen künftigen Beruf als Kaufmann — denn mit diesem schien er sich jetzt doch ausgesöhnt zu haben — noch Vieles fehle, was er in Dortmund nicht erlernen könne, und bat deshalb den Vater, ihn in die Fremde ziehen zu lassen. Und welchen Ort wählte er aus? Keinen andern als den Schauplatz seiner spätern Hauptwirksamkeit als Buchhändler: Leipzig. Freilich dachte er dabei wol nicht an den Mittelpunkt des deutschen Buchhandels, sondern an die Handelsstadt, an die berühmten leipziger Messen, die auch von den dortmunder Kaufleuten regelmäßig besucht wurden. Aber gewiß hatte Leipzig als Buchhändlerstadt für ihn noch einen besondern Zauber, und daß dort zugleich eine Universität war, fiel auch mit in die Wagschale. Ja nach seinen eigenen Aeußerungen scheint es, daß er geradezu die Absicht hatte, auf der dortigen Universität zu studiren. Der Vater gab den Bitten des Sohnes nach. Vielleicht hatte er auch noch einen besondern Grund, den Sohn für einige Zeit aus Dortmund zu entfernen: ein Liebesverhältniß des Sohnes, das fast ein tragisches Ende genommen hätte.
Als der einundzwanzigjährige Jüngling aus der düsseldorfer Lehre zurückkehrte, traf er im älterlichen Hause eine Cousine aus dem benachbarten Soest, die Tochter der an einen dortigen Kaufmann verheiratheten Schwester seines Vaters, von dem Onkel zum längern Besuch eingeladen. Die beiden jungen Leute fanden aneinander Gefallen und besonders schien der junge Mann, der unter seinen Altersgenossen durch lebhaften Geist, höhere Bildung und Interesse an Kunst und Literatur hervorragte und viel von Düsseldorf und seinen Reisen zu erzählen wußte, einen tiefen Eindruck auf das Gemüth des in den einfachsten Verhältnissen aufgewachsenen Mädchens zu machen. Nach ihren eigenen Erzählungen in spätern Lebensjahren sprudelte er damals von Frohsinn und Lebensmuth über und hatte stets ein französisches Chanson auf der Zunge. Sein Vater war natürlich der Ansicht, daß der Sohn noch nicht ans Heirathen denken dürfe, und schritt energisch ein. Das Mädchen nahm sich die Sache sehr zu Herzen: sie stürzte sich aus Verzweiflung in den offenen Brunnen auf dem dortmunder Markte! Glücklich gerettet und zu ihren Aeltern nach Soest gebracht, zog sie sich bald tiefsinnig in ein dortiges Frauenstift zurück; später, nach Auflösung der Klöster und Stifter unter Napoleon's Herrschaft, trat sie indeß ins bürgerliche Leben zurück und heirathete 1809 (also erst in reiferm Alter, 16 Jahre nach dem Liebesverhältniß mit dem jungen Vetter) einen Kaufmann in Soest, wo sie 1843 starb. In ihrem Alter weilte sie immer gern bei der Erinnerung an jene Zeit und erkundigte sich mit Interesse nach allen Verhältnissen ihres verstorbenen Vetters. Wie auf diesen die vom Vater getroffene Entscheidung, die Verzweiflungsthat des Mädchens und ihr Schicksal eingewirkt, ist uns nicht bekannt. In spätern Jahren erkundigte auch er sich oft nach seiner Cousine, ohne sie indeß je wiederzusehen.
Im Sommer 1793 ging Brockhaus nach Leipzig und blieb dort fast anderthalb Jahre, bis Ende 1794. Mit regem Eifer widmete er sich seiner weitern Ausbildung: der Vervollkommnung in den neuern Sprachen sowie dem Studium der allgemeinen Wissenschaften, obwol er unsers Wissens weder in einem kaufmännischen Geschäft angestellt war, noch sich unter die Studirenden aufnehmen lassen konnte. Von Professoren der Universität, deren Vorlesungen er gehört, nennt er den Philosophen Ernst Platner, den Mathematiker und Physiker Hindenburg und den Chemiker Eschenbach. Auch an dem literarischen und buchhändlerischen Leben Leipzigs nahm er das lebhafteste Interesse. Sehr oft besuchte er unter anderm die Köhler'sche Buchhandlung, mit deren Besitzer er durch die mit diesem nahe befreundete dortmunder Familie Varnhagen in Berührung gekommen war, fleißig die neu erschienenen Bücher durchmusternd.
Nur ein einziger Brief von ihm ist aus dieser Zeit erhalten, der aber ein um so merkwürdigeres Actenstück bildet. Es ist dies ein förmlicher Verlagsantrag des noch nicht ganz 22 Jahre zählenden jungen Kaufmanns und Studenten an eine angesehene leipziger Verlagshandlung. Und daß dieser Verlagsantrag kein bloßes Project war, auch keine Gedichtsammlung oder kein Drama, wie sie mancher junge Mann dem Buchhändler als Erstlingswerk anbietet, sondern ein größeres ernstes Werk betraf, geht daraus hervor, daß er dem Briefe einen vollständigen »Plan« des auf 20 Druckbogen berechneten Buchs in Form eines »Prospectus« und sogar einen Theil des fertigen Manuscripts hinzufügt!
Der Brief lautet wörtlich folgendermaßen:
An die Herren Voß und CompMeine Herren!
Aus dem auf der andern Seite folgenden Prospectus werden Sie den Plan und aus den beifolgenden acht Bogen Manuscript die Behandlung eines Buchs sehen, das ich diese Ostermesse — etwa 20 Bogen in 8. stark — herausgeben möchte.
Ich biete es Ihnen zum Verlag an; muß Sie aber ersuchen, mir bis morgen Ihre Entscheidung darüber zukommen zu lassen; — sollten Sie mündlich mit mir darüber sprechen wollen, so wird mir Ihr Besuch morgen früh in der Zeit von 10-12 Uhr sehr angenehm sein.
Den 3. März 1794.
Ihr ergebener Diener F. A. Brockhaus. Wohnt in Nr. 75 im Hay'schen Hause auf der Petersstraße bei dem Friseur Dieterich.Die hier erwähnte »andere Seite« dieses Briefs mit dem »Plan« des Werks findet sich leider in dem Archiv der noch jetzt bestehenden Buchhandlung (die den Brief erst vor einigen Jahren auffand und der Firma F. A. Brockhaus freundlich überließ) ebenso wenig, als die acht Bogen des vermuthlich »Manuscript« gebliebenen Manuscripts vorhanden sind; wir würden daraus wenigstens ersehen haben, auf welche Gegenstände die Studien des jungen Autors in Leipzig vorzugsweise gerichtet waren. Vermuthlich ist ihm von Herrn Voß Beides zurückgegeben worden, und wahrscheinlich im Comptoir der Buchhandlung, nicht in seiner Wohnung, wohin er naiverweise seinen künftigen Verleger bestellt hatte. Ueberhaupt ist der Ton des Briefs, die Sicherheit des Auftretens, das Verlangen einer Entscheidung »bis morgen«, die kurze geschäftsmäßige Form charakteristisch für den Briefschreiber. Derselbe mochte damals nicht ahnen (wie es in der Festrede von Heinrich Brockhaus beim funfzigjährigen Jubiläum der Firma F. A. Brockhaus heißt), »daß er selbst und eine von ihm gegründete Buchhandlung im Laufe der Zeiten selbst so viele Verlagsanträge anzunehmen und — abzulehnen haben würde.«
In Leipzig knüpfte er mit dem Vertreter eines Hauses in Manchester an und wurde von diesem gegen Ende 1794 engagirt, einer in Livorno zu errichtenden Filiale jenes Hauses vorzustehen. In Amsterdam sollte er mit dem Engländer zusammentreffen und zuvor wollte er nur seinen Vater in Dortmund begrüßen. Da brach der Krieg zwischen Frankreich und Italien aus und das englische Haus vertagte seinen Plan auf günstigere Zeiten. Ein Anerbieten desselben, inzwischen eine Stelle auf dem Comptoir in Manchester anzunehmen, lehnte er ab und beschloß, vorläufig in Dortmund zu bleiben. Er etablirte sich auch bald darauf selbständig als Kaufmann, zuerst in Dortmund, dann in Arnheim und endlich in Amsterdam. Diese kaufmännische Wirksamkeit umfaßt die Jahre 1796-1805, also sein dreiundzwanzigstes bis dreiunddreißigstes Lebensjahr.
Brockhaus errichtete in Dortmund ein En-gros-Geschäft in englischen Manufacturen, besonders groben Wollenstoffen, und verband sich dazu mit einem Freunde, Wilhelm Mallinckrodt; Beide nahmen bald darauf noch einen dritten jungen Dortmunder, Gottfried Wilhelm Hiltrop, zum Associé an, und so wurde zwischen ihnen am 15. September 1796 ein Societätsvertrag abgeschlossen. Ihr Geschäft unter der Firma: »Brockhaus, Mallinckrodt und Hiltrop«, nahm bald den erfreulichsten Aufschwung; Brockhaus leitete das Comptoirgeschäft, Mallinckrodt machte die Reisen und hatte das Waarenlager unter sich, während Hiltrop von Anfang an nur eine untergeordnete Rolle spielte. Bald beschlossen denn auch die beiden Freunde, sich von Hiltrop, den sie wesentlich seines bedeutenden Vermögens halber zum Associé genommen hatten, wieder zu trennen, zumal er ihnen seines unverträglichen Charakters wegen lästig geworden war. Sie kündigten ihm im Jahre 1798, zahlten ihm seinen Antheil heraus und zeichneten ihre Firma nunmehr, vom 1. Januar 1799 an: »Brockhaus und Mallinckrodt«; Hiltrop gründete ein eigenes Geschäft gleicher Art in Dortmund. Bald darauf errichteten sie ein zweites Haus in Arnheim unter der Firma: »Mallinckrodt und Compagnie«, und Mallinckrodt zog zu dessen Leitung im Jahre 1801 nach Arnheim, während Brockhaus in Dortmund verblieb. Das Haus in Arnheim war besonders deshalb gegründet worden, weil der Hauptabsatz des dortmunder Geschäfts nach Holland stattfand. Ihr Geschäft nahm einen immer größern Umfang an und die beiden jungen Kaufleute erwarben in wenig Jahren ein bedeutendes Vermögen.
In diese Zeit fällt Beider Verheirathung. Brockhaus vermählte sich am 30. September 1798 mit der Tochter eines der angesehensten dortmunder Patricier, des Senators und Professors Johann Friedrich Beurhaus: Sophie Wilhelmine Arnoldine, geb. 24. December 1777; Mallinckrodt mit einer Freundin derselben. Brockhaus nannte später die ersten drei Jahre seiner Ehe (1798-1800) die glücklichsten seines Lebens. Am 17. Juli 1799 wurde ihm sein erstes Kind geboren: eine Tochter, Auguste; am 23. September 1800 sein erster Sohn: Friedrich.
Dieses Glück sollte aber nicht lange dauern und die Veranlassung dazu bildete der frühere Associé Beider, Hiltrop, obwol derselbe, als ein Verwandter der Familie Beurhaus, mit Brockhaus verwandt geworden war und später sogar sein Schwager wurde, indem er Elisabeth Beurhaus, eine Schwester von Brockhaus' Frau, heirathete. Aus einer geschäftlichen Angelegenheit entwickelten sich bald Verhältnisse der unangenehmsten Art, die zunächst auf Brockhaus' äußeres Leben entscheidenden Einfluß übten. Sie wurden die Ursache, daß er Dortmund verließ und nach Holland zog, ja selbst, daß er sich dort später dem Buchhandel widmete, dem er sich bei seinem Verbleiben in Dortmund schwerlich zugewendet haben würde.
Brockhaus wurde nebst seinem Associé Mallinckrodt von Hiltrop in einen Proceß verwickelt, der unter den Fehden und Anfechtungen, an denen sein Leben reich war, eine der hervorragendsten Stellen einnimmt und ihn mit kürzern oder längern Unterbrechungen bis an sein Lebensende verfolgte. Da der Proceß in dieser Zeit seinen Ursprung hat und mit ihm die nächsten Lebensschicksale von Brockhaus verknüpft sind, so müssen wir denselben jetzt im Zusammenhange erzählen, wenn dadurch auch der Zeit mehrfach vorgegriffen wird.
3.
Der Hiltrop'sche Proceß
Die beste Grundlage zu einer Schilderung dieses Processes, dessen vollständige Darstellung in vieler Hinsicht interessant wäre, hier aber zu weit führen würde, bietet eine von Brockhaus kaum ein Jahr vor seinem Tode veranstaltete und als Manuscript gedruckte Sammlung der darauf bezüglichen wichtigsten Actenstücke, die sowol seine eigenen Eingaben als die ergangenen Urtel, Gutachten u. s. w. enthält und somit ein unparteiisches Urtheil ermöglicht.7
Der Ursprung des Processes und sein erster Verlauf war in Kürze folgender.
Im October 1799 fallirte das Bankhaus Simon Moritz Bethmann in London, mit dem sowol Hiltrop als die Firma Brockhaus & Mallinckrodt in Geschäftsverbindung (Wechselgeschäften) standen. Hiltrop hatte an Bethmann vom April bis September 1799 circa 2800 Pfd. St. remittirt und dagegen Fabrikanten und Kaufleute im Innern von England angewiesen, für Waaren, die sie ihm lieferten, auf Bethmann zu ziehen. Mehrere solche Wechsel waren auch gezogen und bezahlt worden, Hiltrop's Guthaben an Bethmann betrug aber bei Ausbruch des Concurses noch 1806 Pfd. St. Die Firma Brockhaus & Mallinckrodt, welche ebenfalls in einem längern Geschäftsverkehr mit Bethmann gestanden hatte, schuldete dagegen diesem Hause eine Summe von 2204 Pfd. St., die sich aber auf 774 Pfd. St. reducirte, da Bethmann ihnen mehrere Wechsel im Betrage von zusammen 1429 Pfd. St. zurückgegeben oder sie von den daraus entstandenen Verbindlichkeiten gegen die Masse von W. L. Popert u. Comp. in Hamburg (die in der damaligen allgemeinen Handelskrisis ebenfalls fallirten) liberirt hatte. Brockhaus & Mallinckrodt gaben Hiltrop aus freien Stücken Kenntniß von diesem Stande ihrer Rechnung mit Bethmann, um ihm dadurch zur Rettung eines Theils seines Verlustes behülflich zu sein. Hiltrop benutzte dies aber, um sofort unterm 25. November 1799 auf die Forderung der Bethmann'schen Masse an Brockhaus & Mallinckrodt gerichtlich Arrest legen zu lassen. Der Magistrat zu Dortmund bestätigte diese Maßregel.

