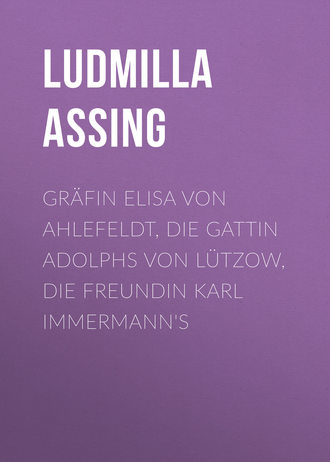
Полная версия
Gräfin Elisa von Ahlefeldt, die Gattin Adolphs von Lützow, die Freundin Karl Immermann's
In Münster sind noch viele Charakterzüge und kleine Anekdoten von dem seltsamen Manne aufbewahrt. Als er einmal bei einem Festmahl einen begeisterten Toast ausbrachte, lehnte er sich in seiner Lebhaftigkeit etwas zu weit zurück, so daß er das Gleichgewicht verlor, und mit sammt seinem Stuhl hinten über auf die Erde fiel; dadurch ließ er sich aber in seiner feurigen Beredtsamkeit nicht stören, und erst als er seinen langen Vortrag ganz beendet hatte, richtete er sich vom Boden auf. – Schon früh zum Wittwer geworden, lebte er lange für sich allein, aber so sehr in seine Studien und Gedanken vertieft, daß er seiner Umgebung wenig achtete. Als später seine würdige Freundin, die alte, vortreffliche Christiane Engels zu ihm zog, um seine Wirthschaft zu führen, fand sie nicht nur, daß er von seinen Leuten um beträchtliche Summen bestohlen worden war, sondern auch, daß in seiner großen, wüsten Wohnung sich Ratten vollauf, groß wie junge Katzen, umhertrieben, die Abends oft drei, vier zugleich, in Gegenwart der Mägde auf den Tisch sprangen, und den Talg von den Leuchtern fraßen. Hatte Möller dies alles nicht bemerkt, so bemerkte er doch das neue Behagen im Hause und den neu geordneten Garten, und dankte der Freundin ihre Fürsorge. – Wie Möller Besuchsreisen zu seinen verheiratheten Kindern machte, geschah es zweimal, daß er nahe daran war, ihnen das Haus anzustecken, da er in seiner Zerstreutheit vergessen hatte, Abends sein Licht auszulöschen; es fehlte wenig, daß in solcher Weise das Feuer, welches er in seinem Gemüthe trug, oben zum Dach herausgeschlagen wäre! –
Für Elisen faßte Möller eine schwärmerische Zuneigung, wie die Briefe beweisen mögen, welche wir von ihm im Anhang mittheilen, da sie, wie wir glauben, von ihm so wie von Elisen ein lebhaftes Bild geben, denn es ist eigenthümlich, daß man diese weit mehr aus den von ihren Freunden an sie gerichteten Briefen, in denen sich der Eindruck, den sie hervorbrachte, abspiegelt, kennen lernt, als aus ihren eigenen Aufzeichnungen und Briefen, die zwar sehr fein und anmuthig sind, aber doch nur einige Seiten ihres Wesens wiedergeben. Sie brauchte darin nie eine leere Phrase, jedes Wort war beseelt, innig, und ihr aus dem Herzen kommend, und entzückte wohl den Empfänger, der sie kannte, und gewissermaßen den Duft ihrer Seele darin empfing, aber die ganze Bedeutsamkeit und Tiefe ihres Innern war daraus nicht wahrzunehmen. Auch in ihrer Art zu sprechen, konnte sie leicht von Andern, selbst von solchen, die geistig weit unter ihr standen, überglänzt werden, denn sie besaß keine Beredtsamkeit, wie zum Beispiel der edle Möller, und wenn sie sich auch wohl graziös und artig auszudrücken wußte, so war dies doch nicht das Hervorstechendste an ihr.
Dagegen konnte sie nicht übertroffen werden an seltenem Schönheitssinn, an Tiefe, Feinheit und Schärfe der Auffassung. Es lag ein Zauber darin, sich mit ihr über Lebensverhältnisse und über Gegenstände der Kunst und Literatur zu unterhalten, weil sie mächtig von allem Schönen ergriffen wurde, und es, wie mit seinen Fühlfäden begabt, überall herausfand; eine edle Regung in einem Menschen, eine bedeutende Idee in einer Dichtung, eine Schönheit in einem Kunstwerk entgingen ihrem Auge nie; sie hatte wie einen sechsten Sinn dafür. Darum war ihr Beifall und ihr Umgang vielen Dichtern und Schriftstellern so unschätzbar, weil sich in Einem Kopfnicken, in Einem zustimmenden Lächeln, in Einem leise hingeworfenen Worte Elisens mehr Verständniß und mehr tiefes Eingehen aussprach, als in mancher geistreichen und wohlgesetzten Rede eines Andern. So sehr wie alles Hohe, Edle und Poetische sie anzog, so sehr war ihr alles Rohe und Gemeine in tiefster Seele zuwider; wenn sie gegen ein Buch, oder einen Menschen ihre Abneigung erklärte, so konnte man sicher sein, daß etwas Unschönes oder Geringes an ihm war. Ihr Urtheil war im Ganzen sehr milde, aber durchaus fest und entschieden; sie ließ sich nie durch fremden Einfluß bestimmen, sondern schöpfte es nur aus ihrem eigenen Geiste und eigenen Gefühl. Eine Dichtung würdigte sie nur als solche, allein vom ästhetischen Standpunkt aus, ohne sich je durch Partheirücksichten dabei beschränken zu lassen. Auf ihre ganze Umgebung wirkte sie so mächtig, daß Jeder, durch sie angefeuert, seine edelsten Seiten herauskehrte, und was von Geist und Talent noch als verschlossene Knospe geruht hatte, ihr gegenüber zur schönsten Blüthe sich entfaltete.
Hiermit glauben wir einigermaßen angedeutet zu haben, wie sehr Elisa befähigt war, der Mittelpunkt einer anregenden und reizvollen Geselligkeit zu sein, ein Talent, das leider immer seltener wird, und beinahe zu verschwinden droht. Sie liebte es, daß man bei ihr vorlas, und dann über das Mitgetheilte seine Gedanken austauschte. Wir nehmen aus dem Briefe einer ihrer Freundinnen die folgende Schilderung jener schönen Abende bei Elisen. »Es bestanden damals Abendcirkel bei der geliebten Elise, an denen sie uns viel, wenn ich nicht sagen will, fast immer Theil nehmen ließ. Es wurde dann vorgelesen, auch mit vertheilten Rollen, wie namentlich »Tasso,« zu dem sie auch uns welche zutheilte. Dabei waren Henriette Paalzow, dann eine würdige, alte, geistreiche Dame, Frau von Aachen, der alte Consistorialrath Möller, zwei Offiziere, Lieutenant Hoffmann und Lieutenant Rördantz, und noch einige Andere, so wie überhaupt dieser Cirkel kein streng abgeschlossener war, und Lützow, so wie noch mehrere ganz heterogene Elemente, den Thee mit dabei tranken, und darauf in abgesonderter Unterhaltung und abgerücktem Platze den Abend auf ihre Weise auch da verlebten. – Sie, die liebliche Sylphe, mit den treuen, blauen Augen, den blonden, klaren Locken, den zarten, durchsichtig weißen, feinen Händen, war die Seele der kleinen Versammlung, und wenn wir uns spät von ihr trennten, und bei Sternenhimmel und Mondenschein der kleine Schwarm heimzog, so war es immer noch in Begeisterung und im Nachhall der schönen Stunden, die wir bei ihr zugebracht, was Eins vom Andern hörte, bis wir uns allgemach auf dem Heimwege von einander abgetrennt hatten. Das war eine liebe, unvergeßliche Zeit!« –
Ein seltsames Mißverständniß war es, daß, als im März 1819 Kotzebue von dem Studenten Sand ermordet worden war, ein ganzer Zug von Münsteranern, die freilich nicht zum nächsten Umgang Elisens gehörten, zu ihr kam, um ihr, die sie an allen Dichtern ein so lebhaftes Interesse nähme, wegen dieses Ereignisses ihr Beileid zu bezeigen. Elisa mußte lächeln, denn grade, weil sie die echten Dichter liebte, war ihr der rohe und gemeine Kotzebue immer zuwider gewesen! –
Im Frühjahr 1819 verließ Adele von A. mit ihrem Gatten Münster, um es gegen Königsberg zu vertauschen. Elisa trat nun mit ihr in eifrigen Briefwechsel, wie sie überhaupt mit allen ihren entfernten Freunden in beständiger Beziehung blieb. Sie vermißte Adelens vertraute Nähe; doch sollte bald darauf eine andere Erscheinung in jenen Kreis voll Empfänglichkeit für alles Schöne und Gute, voll Geist und Leben treten, und dieser schönen Geselligkeit einen neuen Reiz geben; es war dies ein junger Dichter in der ersten Frühlingsfrische seines Daseins, sich des Genius noch kaum ganz bewußt, der eben erst in ihm seine Schwingen zu regen begann. Karl Immermann, geboren 1796 zu Magdeburg, war, nachdem er bei Belle-Alliance den Kampf für das Vaterland mitgekämpft, 1817 in den Staatsdienst getreten, und nachdem er bis 1819 als Referendar in Magdeburg und Groß-Aschersleben gearbeitet, als Auditeur nach Münster versetzt worden.
Der erste Anlaß der Bekanntschaft war ein geschäftlicher. Bei den verwirrten Vermögensverhältnissen des Grafen Friedrich, erhielt Elisa weder ihr mütterliches Erbtheil, noch die ihr von ihrem Vater verheißenen Einkünfte ausgezahlt, und in diesen widrigen Angelegenheiten, die sich jahrelang schon hingezogen hatten, bedurfte Elisa des Raths und der Hülfe eines Rechtskundigen. Der junge Auditeur schien hiezu vorzüglich geeignet, und wurde ihr zugeführt.
Gleich bei dem ersten Besuche war dieser von der neuen Erscheinung, die sich ihm in der reizenden Dame zeigte, wie geblendet und berauscht. Er hatte bisher in ziemlich engen und beschränkten Verhältnissen gelebt, nie war ihm eine Frau vorgekommen, die auch nur entfernt an diese heranreichte. Alle die Eigenschaften, welche wir an ihr geschildert, mußten ihn unwiderstehlich zu ihr hinziehen; er glaubte das Ideal seiner Träume verwirklicht zu sehen. Nie hat Tasso mit mehr Bewunderung und Liebe zu der Prinzessin von Este aufgeblickt, als Karl Immermann zu Elisen. Dieser Vergleich liegt uns um so näher, da Elisens Freunde sie häufig der edlen Leonore ähnlich fanden; sie hatte dieselbe feine, vornehme Seele, den milden Ernst, die mondscheinartige Schwermuth, die sanftglühende Innigkeit wie jene, und die Hoheit ihres Wesens gebot zugleich Scheu, indem sie anzog.
Immermann hatte wohl schon auf der Universität seine ersten dichterischen Versuche gemacht, aber hier in Münster erst, in so begeisternder und fördernder Nähe, erwachte in ihm mächtig die Lust zum dichterischen Schaffen, und in rascher Folge entstanden in den vier Jahren, welche er in Münster zubrachte, unter den Augen Elisens die Gedichte »Jung Osrik« und »das Requiem,« das Lustspiel »die Prinzen von Syracus,« die Trauerspiele »das Thal von Ronceval,« »Edwin,« »Petrarca,« eine Sammlung Gedichte und der viel zu wenig bekannt gewordene Roman »die Papierfenster eines Eremiten,« in dem die Seelenzustände eines feurigen, jungen Herzens mit großer Wahrheit geschildert sind. Dann dichtete er das Trauerspiel »König Periander und sein Haus,« das Lustspiel »das Auge der Liebe« und endlich die feine und geistvolle Novelle, »der neue Pygmalion.«
Er selbst war nicht weniger als seine Freunde erstaunt über diese plötzliche Productionskraft, die wie ein neues Glück über ihn gekommen war; in zarten, lyrischen Ergüssen, die er niemand zu zeigen wagte, feierte er diejenige, welche durch ihre Anregung all diesen Reichthum in ihm geweckt hatte, und in seine entzückte Dankbarkeit mischte sich der Schmerz, daß sie ihm so unerreichbar fern stand, noch ferner als Tasso'n Leonore.
Elisa genoß mit reiner Freude diesen Verkehr mit einem jugendlich strebsamen Geiste, der sich so schön entfaltete. Ihre Gesellschaftsabende nahmen einen noch lebhafteren Aufschwung als zuvor; oft las Immermann dort mit seiner kräftigen, wohltönenden Stimme aus Goethe, Kleist, Shakespear und Calderon vor, und fesselte durch seinen ausdrucksvollen Vortrag; dazwischen las er seine eigenen Werke, in denen er die Empfindungen seines Herzens frei ausströmen ließ; die Gespräche, welche sich daran knüpften, waren für den jungen Dichter von unbeschreiblichem Werth, und besonders Elisens Urtheil entscheidend für ihn. Seine glänzenden Gaben kamen hier zur schönsten Geltung; eine eigenthümliche Mischung von scharfem Verstand und lebhafter Phantasie, eine liebenswürdige Erregtheit, gaben seiner Persönlichkeit etwas ungemein Gewinnendes.
Adolf Stahr, in seiner vortrefflichen Biographie Immermann's, schildert uns den Dichter, wie er ihn gesehen, als er bereits in den Vierzigen war, von mittler Größe, aber stark und kräftig gebaut, eine gedrungene, antike, römische Gestalt mit breiter Brust und starken Schultern, wie einer der alten Imperatoren. »Eine breite, hohe majestätische Stirn,« sagt Stahr weiter, »von dem starken, dunkeln, schon hier und da in's Graue neigenden, schlichten Haare mäßig beschattet, spiegelte eine gehaltene Hoheit und Ruhe, welche durch die kräftig geschlossenen Lippen und das scharf und tief blickende Auge zu dem Charakter strengen Ernstes und fester Entschlossenheit gesteigert wurde.« Damals jedoch, wo Elisa Immermann kennen lernte, war er dreiundzwanzig Jahre, schlank und jugendfrisch, ein poetischer Schmelz verklärte seine Züge, und aus den dunkeln, herrlichen Augen strahlte Geist und Leben.
In dem Freundeskreis, der Elisen umgab, mußte sie umsomehr Trost suchen, da die Betrachtung der allgemeinen Zustände wenig Erfreuliches hatte. Man mußte sich eingestehen, daß die Hoffnungen, welche man auf den Befreiungskrieg gesetzt, nicht in Erfüllung gegangen waren, dem Aufschwung war eine Erschlaffung gefolgt, die verheißenen Freiheiten nicht gewährt worden; die Lützower besonders waren unzufrieden, und hatten Ursache es zu sein, da man sie eher zurücksetzte, als nach Verdienst anerkannte. – Lützow war oft verstimmt, und fühlte sich gekränkt, Friedrich von Petersdorff, den die Gegenwart so wenig befriedigte, daß sein sehnlichster Wunsch dahin ging, sich einmal mit seiner Familie in die tiefste Stille auf's Land zurückziehen zu können, schrieb aus Memel klagend an Elisen: »Seit Friesen nicht mehr ist, sind Sie die Einzige, mit der ich die alten Zeiten mit den neuen vergleichen kann. Das Ideal, das uns damals vorschwebte, worauf wir mit graden Schritten loszugehn glaubten, das wir zu erreichen gewiß hoffen konnten, ist nicht allein weit entfernter von uns, sondern sogar jede Hoffnung es zu erreichen verschwunden. – Meine Idee von der Menschheit Glück ist noch dieselbe wie damals in Breslau, wo die Unterhaltung mit Ihnen darüber mir viele herrliche Stunden bereitete, doch bald nachher, noch in den ersten sechs Monaten, fand ich, daß meine Idee nur Wenige ansprach, und ich zog mich in mich selbst zurück, und ließ geschehn was ich nicht ändern konnte, ohne weiter Theil zu nehmen an dem, was geschah. – Wenn wir uns zu Zeiten einige Stunden sprechen könnten, dann wäre ich ganz glücklich, Elisa! Denn das ist, was mir hier ganz fehlt, ein Freund oder eine Freundin aus jener Zeit der glücklichen Ideenwelt. Die Zeit ist nun ganz vorüber, der schimmernde Stern verlosch schnell, so sehr schnell und bald, daß er nur ein schönes Traumgesicht gewesen, aber Sie, theuerste Elisa, sahen mit mir den Stern hell leuchten, und seine Strahlen werden unsre Herzen bis in den Tod erwärmen.« –
Elisa fühlte mit dem Freunde, daß die damaligen Zeiten verklungen waren, hatte aber doch wirksame Worte des Trostes für ihn, auf die er erwiederte: »Ihre Freundschaft macht mich unendlich glücklich, sie giebt meinem Leben einen goldenen Schein der freudigsten Phantasie, durch den ich immer in jenen Zeiten erhalten werde, wo die Hoffnungen zur Erreichung einer allgemeinen Beglückung uns beseligten. Durch das Andenken an jene Zeit, in welcher mir Ihre Freundschaft zuerst zu Theil wurde, schwindet die allgemeine Gegenwart, und jeder Brief von Ihnen überzeugt mich, daß, obgleich werthlos für's Allgemeine jene Zeit hinabgesunken, ist mir doch ein köstlicher Juwel – Ihre Freundschaft geblieben. Manchmal scheint es mir, als hätte ich in voriger Zeit geträumt, dann denke ich an Sie, an die hohe Begeisterung, die sich in Ihnen aussprach, und ich fühle mich wieder in die Wirklichkeit versetzt, die Ueberzeugung gewinnt neue Stärke in mir, daß, wenn ich es auch nicht erlebe, doch einmal gewiß die Zeit der Wahrheit kommen wird. Ihr Blick strahlte diese Zuversicht in mein Herz, die unveränderliche Verehrung für Sie wird sie mir bis an das Ende meines Lebens erhalten!« –
Von allen Seiten trafen Elisen in jener Zeit betrübende Eindrücke. Von ihrem Vater erhielt sie nur wenig Nachrichten; er war ihr um so mehr entfremdet worden, als er sich schon vor längerer Zeit mit einer Frau verheirathet hatte, die an Stand, Alter und Erziehung sehr verschieden von ihm und wenig seiner würdig war. – Lützow's Bruder Wilhelm verlobte sich Ende 1819, und Elisa konnte sich dabei einer stillen Wehmuth nicht erwehren, weil sie richtig vorausfühlte, daß die künftige Gattin für den Schwager wenig passen, und ihn schwerlich befriedigen würde; doch konnte sie damals noch nicht ahnen, daß jene dazu bestimmt war, später ihre eigene Stelle einzunehmen! –
Im Jahre 1820 trafen von Johanna Motherby beunruhigende Briefe ein; die leidenschaftliche Frau hatte ihren Gatten und ihre beiden Kinder verlassen, um dem jungen Arzte Johann Friedrich Dieffenbach nachzureisen, von dessen eigenthümlich gewinnender Persönlichkeit sie in dem Grade bezaubert war, daß sie glaubte, nicht ohne ihn leben zu können. Viele ihrer Freunde wandten sich in Mißbilligung und Tadel von ihr ab, Elisa aber, die ganz andere Begriffe von Freundschaft hatte, bewahrte ihr nur um so treuer ihre Anhänglichkeit, und erwies sich ihr um so eifriger hülfreich und antheilvoll, da sie die Arme bedauerte, und dabei fürchten mußte, daß das neue Verhältniß ein unglückliches Ende nehmen würde.
Ein Vetter Elisens aus Dänemark kam zum Besuch zu ihr, um sich in ihrer Nähe Trost und Zerstreuung zu suchen gegen häusliche Verdrüsse, da er im Begriff war, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Auch Henriette Paalzow lebte in sehr unglücklicher Ehe.
So sah Elisa, Adele von A. ausgenommen, die in sehr beglückenden Verhältnissen lebte, rings um sich her lauter unglückliche Ehen! –
Eine Reise, die sie mit Lützow an den Rhein machte, dessen poetische Ufer sie sehr liebte, gab einige angenehme Zerstreuung.
Im Herbst dieses Jahres bezog sie mit Lützow das Wittig'sche Haus in Münster, ein ehemaliges Kloster, welches jetzt zur Dienstwohnung eingerichtet war. Die äußeren Mauern des alterthümlichen Gebäudes waren mit Statuen von Heiligen und anderer Schnitzarbeit verziert. Die inneren Räume sahen ernst und feierlich aus; die hohen Fenster, die mächtigen Flügelthüren hatten etwas Schloßartiges; Elisa erschien darin wie eine Ritterdame aus der alten Zeit. Sie besaß ein besonderes Talent, sich ihre Zimmer mit Sinn und Geschmack auszuschmücken. Man glaubte in eine schönere Welt zu gelangen, sicher in eine, in der ein guter Genius waltete, wenn man ihre Wohnung betrat. Dort lebte sie unter Blumen, Büsten, Büchern und Bildern, umgeben von ihren Vögeln und Hunden, unter denen der große, schöne Hector, vom Schlachtfeld von Belle-Alliance, eine Hauptperson war, meist entweder an ihrem Schreibtisch oder dem Stickrahmen beschäftigt, oder auch lesend. Die holde Freundlichkeit, mit der sie jeden Besucher empfing, hatte darum etwas so Herzgewinnendes, weil sie aus dem Herzen kam.
Einen zu ihrer Wohnung gehörenden Garten besorgte Elisa selbst wie eine Gärtnerin, und die Blumen und Gesträuche gediehen auf das schönste unter ihrer Pflege; eine schattige Weinlaube vereinigte oft den Freundeskreis, der sie umgab. Immermann erschien auch oft allein, da Elisa, die des Englischen sehr kundig war, ihm in dieser Sprache Unterricht ertheilte; in artigen, englischen Billetten schalt sie ihn aus, wenn er nicht fleißig genug war, und er entgegnete ihr darauf in scherzhaften englischen Gedichten. Ein deutsches Gedicht Immermann's aus jener Zeit an Elisen theilen wir mit, das, am Todestage ihrer Mutter verfaßt, sie in zarter Weise über diesen Verlust zu trösten sucht. Es lautet:
Die Blumen an eine trauernde Tochter, am 30. MärzDer fromme Schmerz zieht seine NebelschleierVor Deiner Augen himmelvolle Sterne,Ach, einer theuren Todten gilt die Feier,Die Wehmuth naht, Du hegst die Wehmuth gerne,Nun lichtet sich der Blick, nun wird er freier,Es dringet Sehnsucht in die weitste Ferne –Allein ermattet sinkt die Seele wiederAuf jenem öden dunkeln Grabe nieder.Da treibt es uns, von unten aufzubringenUns selbst zu Dir, und Trost zu Deinem Leid!Wir möchten Dir zu Brust und Herzen dringenMit tiefster Treue ganzer Innigkeit!Uns hat ein Gott in seiner Liebe RingenZu frohen Boten immerdar geweiht:Daß Leben schlägt und glüht an jedem Orte,Und daß der Tod ein Wort, wie andre Worte.Denn lagen wir nicht dürftig eingefaltetUnd stumm und bang in unserm kleinen Grabe?Denn waren wir nicht ganz und gar erkaltet,Vom feuchten Frost in unserm schaur'gen Grabe?Hat nicht das Schweigen räthselvoll gewaltetAuch über uns, auch über unserm Grabe?Nun sieh, wie dennoch Wärm' und Licht verbündet,Zu Farb' und Duft uns wunderbar entzündet!Und Farb' und Duft, sie wünschen auszusagenDie eine unbegreiflich hohe Kunde!Doch weil das Siegel unsre Lippen tragen,Küßt Ahnung nur sie still von Blumenmunde,Die Welt hat keine Zeit zu Schmerz und Klagen,Der reichste Segen keimt aus schwerster Wunde.Wir täuschen nicht! Das ist nicht eitel Wähnen!Die Mutter trocknet Dir durch und die Thränen.Auch die folgenden Verse Immermann's gehören hierher:
Nicht immer füllenDie schwebenden HorenDen Becher der FreudeMit frischem Wein!Dann geh zum BornDer heil'gen ErinnrungUnd trinke Dir MuthFür heut' und morgen!Im Herbst 1821 reiste Elisa mit Lützow nach Berlin, wo sie alte Freunde und Bekannte wiedersahen. Im Anfang des folgenden Jahres kam Johanna Motherby nach Münster, und ihr scharfer Blick entdeckte bald die heftige Neigung Immermann's, die er bisher möglichst zu verbergen gesucht hatte, und die Elisa noch nicht in ihrem ganzen Umfang ahnte. Hier wären zwei Menschen, die für einander bestimmt seien, äußerte Johanna in ihrer lebhaften Weise, und beklagte, daß die Verhältnisse sie trennten. Sie selbst war damals von den leidenschaftlichsten Empfindungen zerrissen, die durch die Trennung von ihren Kindern, und die mancherlei Hindernisse, welche ihrer Verbindung mit Dieffenbach noch im Wege standen, veranlaßt wurden.
Lützow's Ernennung zum General, die im Jahre 1822 erfolgte, brachte in Elisens Verhältnissen keine Veränderung hervor.
Wir haben schon früher erwähnt, daß die Charaktere von Lützow und Elisen eigentlich wenig zu einander paßten, doch hatte letztere immer in dem Gedanken Beruhigung gefunden, daß sie an ihm einen treuen Freund besäße, der ihr von ganzem Herzen ergeben sei. Um so mehr wurde sie betroffen, als Lützow eines Tages mit einem alten Kriegskameraden plaudernd im Garten saß und in ihrer Gegenwart darauf die Rede kam, daß Lützow, der anwesende Freund und noch zwei andre Offiziere sich als junge Leute verabredet hatten, sie wollten alle darauf ausgehen, reiche Frauen zu heirathen. Es wurde davon ganz offenherzig und in etwas derben Scherzreden gesprochen und zugleich erwähnt, daß keiner von den Vieren sein Ziel erreicht habe, denn zwei blieben unvermählt, und die andern beiden waren in ihren Erwartungen getäuscht worden, indem sie mit ihren Gattinnen nicht so bedeutendes Vermögen erhielten, als sie vermutheten. Zu diesen Letzteren gehörte auch Lützow, da ja Elisen das ihr gebührende Vermögen vorenthalten war.
Wie ein Stich in's Herz traf sie diese Entdeckung! Daß solche Motive bei Lützow's Bewerbungen mitgewirkt, wie hätte sie das je ahnen können! Und hier hörte sie von ihm selbst dieses Geständniß, ohne Rückhalt, wie einen lustigen Spaß, der niemand verletzen könne! – Welche andre Illusionen hatte sie gehegt, als sie bei ihrem Vater so treu und beständig diese Verbindung durchgesetzt! So jung, so schön, so liebenswürdig und begabt, und doch um des Geldes willen geheirathet! – Eine so schmerzliche Täuschung war schwer zu überwinden. –
Wir würden Lützow Unrecht thun, wenn wir glauben wollten, daß nur ein solcher Beweggrund ihn hätte Elisen erwählen lassen, gewiß erkannte er ihre edlen Eigenschaften, aber schlimm genug blieb es immer, daß ihr Reichthum eine so große Rolle dabei gespielt. Johanna Motherby und Adele von A. scheinen die Einzigen gewesen zu sein, denen Elisa ihr Leid anvertraute. Tröstend schrieb ihr die Letztere, den 16. November 1822: »Wehre dem Trübsinn! Fühlst Du es nicht, wie Dein eigentliches Sein und Wesen gewiß nur beglückt und darüber jegliches andere Gut, das doch nur der bloßen Existenz wegen zu berücksichtigen bleibt, gänzlich davon abfallen muß. Traute Elise, sei doch froh! – In Dir liegt ein reicher Schatz, Du hast der köstlichen Gaben so viele – und Du beglückst!« –
Im Sommer 1823 machte Elisa mit Lützow eine Reise nach Bremen, bei welcher Gelegenheit sie ihre alte Erzieherin wiedersah; diese wohnte seit längerer Zeit in Hamburg und war ihrem geliebten Zögling bis nach Rothenburg entgegen geeilt. Wie sehr Marianne Philipi Elisen schätzte, geht unter anderem aus der folgenden Briefstelle hervor: »Auch Du, meine gute, fromme, sanfte Elisa, kannst hoffnungs- und vertrauungsvoll in die Zukunft blicken, denn Du hast viel geliebt, viel gelitten, viel geduldet. Das Geschick, indem es meine Kindheit und Jugend durch rauhe Wege führte, verfuhr ernst mit mir, wodurch sich jedoch manches in meinem Innern glücklicher für mich entwickeln mußte. Wenn die Vorsehung aus uns unbegreiflichen Absichten einen andern Weg mit Dir ging, wer darf sich erkühnen, sie zu tadeln? Auf den Händen der Liebe in Deiner Kindheit getragen, von den Menschen und dem Glück geliebkoset, verzärtelt, Dir unbewußt von tausend Gefahren umringt, mußte das Leben eine ganz andre Gestalt gewinnen, die Täuschungen des schönen Frühlingsalters Dir erst später entschwinden. Setze mich in Deine so vortheilhaft scheinende Lage, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, aber gewiß keine sanft duldende, genügsame Elisa.« –
Das Jahr 1824 brachte nur düstre und verhängnißvolle Ereignisse. Elisens Vater, welcher trotz aller Bedrängniß seiner Vermögensangelegenheiten sein vergnügungssüchtiges Leben unverändert fortsetzte, war bei einer Gesellschaft, die er am Geburtstage des Königs von Dänemark bei sich vereinigt hatte, von einem Nervenschlag betroffen worden, und man mußte ihn bewußtlos von der Tafel forttragen; er erholte sich zwar wieder, jedoch sehr langsam. Von seiner zweiten Gattin hatte er sich bereits wieder getrennt.



