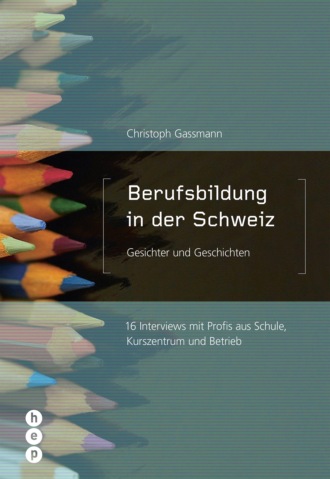
Полная версия
Berufsbildung in der Schweiz - Gesichter und Geschichten

Wird aus Ihrer Sicht im Unterricht an Berufsfachschulen zu wenig Wert auf verständliche Texte gelegt?
Wenn ich mir die Berufskundebücher anschaue, würde ich sagen: ja. Oft kommen die Lernenden mit Lehrmitteln an, die ich selbst manchmal zwei- oder dreimal lesen muss, bis ich sie verstanden habe. Für den allgemeinbildenden Unterricht und die ABU-Lehrmittel gilt das weniger.
Allerdings kann ich mit einer Klasse auf der Basis eines einzigen Lehrmittels ohnehin nicht den ganzen Schullehrplan durcharbeiten, das weiss jeder, das wissen auch die Autoren. Ich sehe die Lehrmittel inzwischen als eine Art Steinbruch, aus dem ich mich bediene. Je nach Thema kann man sie nicht eins zu eins für jede Stufe verwenden, das würde nicht funktionieren. Man muss die Inhalte «herunterbrechen» und der Stufe, auch der Berufsgruppe anpassen. Mit Grafikern, Fotofachleuten oder Werbetechnikern arbeite ich anders als mit Malern. Vierjährige Lehren unterscheiden sich oft vom Niveau her stark von den dreijährigen. Und auch dort gibt es wiederum Stufungen. Selbst innerhalb einer Klasse sind die Unterschiede manchmal beträchtlich. Einzelne Lernende könnten ohne Weiteres ein Studium bewältigen, für andere ist Deutsch eine Zweitsprache, die sie nicht unbedingt auf einem hohen Level beherrschen. – Da sind wir gefordert, das ist auch der Grund, weshalb wir mit einem Lehrmittel nicht auskommen. Man muss modifizieren, differenzieren; man muss, wenn man die Klasse kennt und die Abstufungen erkannt hat, diese Differenzierungen selbst vornehmen. Das ist sehr zeitaufwendig und gelingt nicht immer.
Sie unterrichten im ABU-Rahmen in einem gewissen Sinne auch Deutsch. War das nie ein Problem, dass Deutsch, selbst wenn Sie es studiert haben und ausgezeichnet beherrschen, für Sie eine Fremdsprache ist?
Im Gegenteil. Die Schüler lassen sich so schnell überzeugen, dass Hochdeutsch die Unterrichtssprache ist, nicht Dialekt. Die Akzeptanz kommt viel natürlicher. Ich kann kein Schweizerdeutsch, ich kann keine Mundart, auch wenn ich alles verstehe. Dass ABU nach dem pädagogischen Konzept in der Standardsprache unterrichtet werden soll, ist eine Erleichterung für mich.
Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal eine Schülerin in der Klasse, die ebenfalls Türkin ist. In schwächeren Klassen, in denen ich Stellvertretungen übernommen habe, zum Beispiel bei den Malern oder Carossierlackierern, hat es aber oft Türken. Wenn sie erfahren, dass auch eine Türkin gut Deutsch sprechen kann, ist das für sie motivierend: Gut Deutsch zu sprechen, ist machbar. Dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist, war also nie ein Problem.
In Klassen mit hohem Migrantenanteil finde ich meist schnell den Draht zu den Schülern. Manchmal geht es so weit, dass sie mich beknien, etwas auf Türkisch zu sagen, weil sie nicht glauben wollen, dass ich Türkin bin. Das mache ich dann, das ist immer sehr lustig.
Ich hatte mit solchen Klassen auch nie disziplinarische Probleme, es gab keine Widerstände. Obwohl ich viel fordere, machen die Lernenden mit. Das sind Indizien für mich, dass die Akzeptanz da ist. Es gibt kein Misstrauen, im Gegenteil.
Es gibt nicht viele ABU-Lehrpersonen mit Migrationshintergrund ...
Das ist richtig. Allerdings ist es in der Schweiz schwer zu erkennen, ob jemand einen Migrationshintergrund hat, es könnte auch ein Tessiner sein oder eine Welschschweizerin. Es kommt auch darauf an, wen man dazuzählen will. Deutsche gelten in diesem Diskurs ja kaum als Migranten? Deutschen bin ich im Studium einigen begegnet. Ich habe mit ihnen aber nie über ihre Schwierigkeiten hinsichtlich der Akzeptanz gesprochen. Dieses Thema existiert für mich auch eigentlich gar nicht.
Im Ernst?
Als ich in die Schweiz kam, studierte ich zuerst an der Hochschule Luzern Kulturmanagement, dann arbeitete ich beim Forum Claque in Baden, besorgte dort die Öffentlichkeitsarbeit, Presse usw. Im Kulturbetrieb fragte niemand, woher ich kam. Das fand ich sehr angenehm, die Herkunft war bedeutungslos, Hauptsache, man machte seine Arbeit gut. Das ist auch mein Arbeitsverständnis. Mit dieser Kulturalisierung, Ethnisierung kann ich nichts anfangen. Ich enttäusche in der Schweiz oft mein Gegenüber, wenn ich mich nicht als Kurdin oute. Dieses Kokettieren mit dem Ethnischen ist ein Zeichen des Zeitgeistes, das ist nicht mein Ding. Ich möchte einfach gute Arbeit leisten.
Es ist ja vielleicht der Impuls, verstehen zu wollen, warum die Menschen so sind, wie sie sind, warum sie sich auf eine bestimmte Art verhalten. Die Verhaltensweisen, die Denkweisen sind ja doch oft spürbar unterschiedlich, sie unterscheiden sich natürlich von Mensch zu Mensch, aber man überlegt sich, ob es vielleicht auch mit der Herkunft zu tun haben könnte. Und ich möchte’s ja verstehen ...
Das kann ich nachvollziehen. Tatsächlich reagieren die Schüler oft auf besondere Weise, je nachdem, woher sie kommen. Schüler aus Ex-Jugoslawien reagieren auf bestimmte Aussagen oder Inhalte anders als Schweizer, das verstehe ich, darauf kann ich mir einen Reim machen.
Von «Migrationshintergrund» zu sprechen, ist ohnehin sehr unpräzise.
Heutzutage bedeutet es nichts, wir sollten wegkommen davon ... Anderseits bedeuten Unterschiede ja auch eine Bereicherung. Aber ich möchte gar nicht darüber reden.
Wie sind Sie denn zum Unterrichten gekommen?
Neben meinem Hauptstudium in Germanistik hatte ich in Istanbul auch Zusatzzertifikate in Pädagogik, Didaktik und «Psychologie der Pubertät», wie es damals so schön hiess, erworben.
So ganz ohne pädagogischen Background bin ich also nicht ins Unterrichtsgeschäft eingestiegen. In der Schweiz arbeitete ich parallel zu meiner Tätigkeit im Kulturmanagement in einem Schulheim auch schon lerntherapeutisch und heilpädagogisch, mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, aber immer im Einzelunterricht.
Ich hatte mir, als ich in die Schweiz kam, überlegt, ob ich in meinem Forschungsgebiet weiterarbeiten wollte. Aber da ich mich in Istanbul stark auf das Sprachenpaar Deutsch-Türkisch spezialisiert hatte, konnte ich damit hier nicht viel anfangen. Natürlich hatte ich nie daran gedacht, dass ich einmal in der Schweiz leben würde, ich war davon ausgegangen, dass ich in Istanbul leben und im Laufe meiner akademischen Karriere irgendwann Professorin werden würde. Meine Kollegen sind es geworden, und vom Alter her wäre ich inzwischen auch so weit.
Bereuen Sie es, dass es nicht so gekommen ist?
Auf keinen Fall. In der Schweiz hatte ich die Möglichkeit, in verschiedenen Gebieten zu arbeiten und neue Einblicke zu gewinnen. Ich sehe das als grosse Bereicherung.
Und ABU zu unterrichten, ist etwas vom Vielfältigsten, was es gibt, ich bin immer noch erstaunt, mit welcher Vielfalt von Fragen und Themen ich mich täglich auseinandersetze.
Wie sind Sie denn zum ABU gekommen?
Das war Zufall. Nach jahrelanger Arbeit mit Verhaltensauffälligen wollte ich etwas anderes machen, ich hatte das Gefühl, ich hätte die Relation zum «Normalen» verloren, diese Eins-zu-eins-Situationen mit Kindern und Jugendlichen waren mir allmählich zu nah, die Einzelschulung dauerte immer ein Jahr, da ergibt sich eine sehr enge Beziehung zu einem Menschen, und ich empfand es als auslaugend, es war mir allmählich zu viel Auffälligkeit, ich brauchte wieder die Distanz – zur Klasse, zur Gruppe. Im Kulturmanagement wollte ich auch nicht mehr arbeiten, wollte nicht mehr wegen jedem Rappen streiten (Sponsoring und Fundraising gehörten auch in meinen Aufgabenbereich). Kulturmanagement ist ein hartes Pflaster. Es ist ein Überlebenskampf, gerade in der freien Szene. Und die Gelder werden ständig gekürzt ... Von einem bestimmten Punkt an kann man die Qualität nicht mehr bieten, die von einem verlangt wird. Kurz: Es hat mich zu wenig genährt, innerlich.
So habe ich mich auf die Suche gemacht und bin auf ein Zeitungsinserat gestossen, in dem eine ABU-Stelle angeboten wurde. Ich habe mich beworben.
Wussten Sie denn, was ABU ist?
Ich hatte keine Ahnung, hatte noch nie davon gehört – wirklich nicht. Ich machte mich dann im Internet kundig und fand, das klinge vielfältig, das könnte spannend sein.
Ich wollte unterrichten. Ich arbeite gerne mit jungen Menschen zusammen und begleite sie gern ein Stück weit, es ist im Gegensatz zu dem, was ich im Kulturmanagement erlebt habe, eine sehr nährende Sache.
Ich kenne Schweizer, die nichts mit der Berufsbildung zu tun haben, die auch nicht wissen, was ABU ist. Wenn man sagt «allgemeinbildender Unterricht», stellen sie sich etwas Uferloses vor, ein grenzenloses Feld: «Wie kann man denn so etwas unterrichten?»
Es ist tatsächlich uferlos, drei, vier Jahre braucht es schon, bis man sich einigermassen eingearbeitet hat. Am Anfang ist man erschlagen, mir jedenfalls ging es so, man sieht vor lauter Meer den Horizont nicht und versucht, sich eben über Wasser zu halten, und dieses Sich-über-Wasser-Halten ist eine extrem zeitaufwendige Sache. Natürlich gibt es das System des Mentorats. Trotzdem, auch wenn der Mentor, die Mentorin einem zum Beispiel Arbeitsunterlagen oder Bücher in die Hand drückt, muss man sich in die Materie erst einmal einarbeiten. Ich hatte doch keine Ahnung von Kauf-vertrag oder von den Dingen, die man als Schweizer Konsument wissen muss, oder von den Pflichten eines Lehrlings, und diese Liste von Themen und Fragen ist sehr, sehr lang. Sich in diese Materie so weit einzuarbeiten, bis man vor der Klasse stehen kann mit einer inneren Sicherheit, dem Gefühl, sich den Stoff einigermassen erarbeitet, die eigenen Wissenslücken so weit geschlossen zu haben, dass man glaubwürdig ist, das braucht Zeit. Es kommt immer noch vor, dass ich eine Frage nicht beantworten kann. Aber ich habe heute einen guten Umgang mit Lücken gefunden. Ich bin kein wandelndes Lexikon, auch ein ABU-Lehrer weiss nicht alles, aber ich kann sagen: Ich gehe dieser Frage nach. Diese Offenheit, diese Kultur des Auch-nicht-wissen-Dürfens, das akzeptieren die Schüler, wenn man es selbst nicht als Defizit darstellt. Aber in der nächsten Unterrichtsstunde muss die Information geliefert werden. Die Schüler vergessen vielleicht, dass da eine offene Frage war, die Lehrperson darf es nicht vergessen, sie muss darauf zurückkommen.
Sie können ihre Fragen auch auf einem Flipchart notieren, einen Fragenpool sammeln. Und manchmal wissen die Schüler auch mehr zu einem Thema, sodass sie dann selbst Antworten geben können, das ergibt ein sehr befruchtendes, sehr natürliches Lernklima.
Die Breite des Stoffs ist bestimmt eine Herausforderung, aber eine andere liegt bei den Lernenden, nehme ich an.
Absolut. Ich hatte ja schon fast alle Alterskategorien unterrichtet – bis hin zur Tertiärstufe. Die einzige Stufe, die fehlte, war die Sekundarstufe II, die Jugendlichen. Aber das ist etwas vom Herausforderndsten, was man sich denken kann.
Es ist ein anspruchsvolles Alter – das Erwachsenwerden, der Übergang ins Berufsleben. Die Schüler kommen zum Teil mit 15, werden gerade 16. Für den Einstieg ins Berufsleben ist 16 früh, sehr früh. Die jungen Menschen entwickeln sich schnell, sie verändern sich schnell. Ich werde im nächsten Juni meine erste vierjährige Klasse verabschieden, am Anfang hatte ich Kinder vor mir, heute sind es Erwachsene. Natürlich entwickeln sie sich auch in der Primarstufe, aber hier kommt die Eigenverantwortung für ihr Leben hinzu, sie gehen von der Schule ab mit einem Diplom, einem Zeugnis, um sich dann im Leben selbstständig, auf eigenen Füssen zu behaupten. Das gibt es in keiner anderen Schulstufe. Primarschüler stehen nach der Schule nicht «im Leben».
Es sind ganz andere Themen, die die Berufsschüler beschäftigen. Zusammenziehen mit Partner oder Partnerin, Wohnungssuche, Ausziehen von zu Hause. Es ist eine Phase, die grosse Umwälzungen mit sich bringt. Oft haben die jungen Leute die Schule gar nicht in ihrem Fokus, verständlicherweise, aber sie müssen da durch. Es ist eine sehr spannende Lebensphase, und sie darin zu beobachten – nicht immer können wir sie begleiten –, das ist oft faszinierend. Das ist etwas, was eine Lehrperson auch nach langer Zeit im Beruf noch begeistern kann, Zeuge dieser Entwicklung zu sein. Wenn ich sie auf diesem Weg sogar begleiten darf, ist es noch spannender.
Ihr seht sie ja in der Berufsschule nicht so häufig.
Ja, das empfinde ich manchmal als Nachteil, aber je älter sie werden, desto passender ist es auch. Diese nahe Beziehung, die braucht es nicht, sie holen sich das Wissen ab und gehen wieder. Das ist wie bei uns Erwachsenen, wenn wir eine Weiterbildung besuchen, wir gehen hin, holen uns ab, was wir brauchen, und verabschieden uns. Für den Beziehungsaufbau sind drei Stunden wöchentlich natürlich wenig. Und ohne Beziehung ist ein gutes Lernklima nicht möglich, diese Beziehung muss also erst aufgebaut werden. Dafür braucht es Zeit. Und wenn es wie bei mir grosse Klassen sind, mit zwanzig Schülern oder mehr, ist es nicht leicht, das Individuum wahrzunehmen und den Lernenden das Gefühl zu vermitteln, dass sie wahrgenommen werden, das geht nicht von heute auf morgen, da muss man sich Zeit nehmen. Aber auch nicht zu viel Zeit – Klassendynamiken entwickeln sich sehr rasch und unberechenbar, und wenn da etwas festgefahren ist oder wenn irgendetwas nicht gut läuft, kann das Klima sehr rasch kippen, und das dann wieder zurechtzubiegen in der zur Verfügung stehenden Zeit, kann schwierig werden.
Haben Sie das erlebt?
Ich habe das mit einer Klasse erlebt, ganz am Anfang. Es waren 22 Schülerinnen und Schüler, meine erste Klasse, und ich habe dort, weil ich neu war, weil ich die Stufe nicht kannte, Fehler gemacht, eindeutige Fehler. – Ich führe sehr straff, ich habe die Zügel in der Hand und setze klare Strukturen, fordere diese auch ein. Vereinbarungen müssen bei mir eingehalten werden. Diese Schüler fühlten sich nun von mir aber nicht wahrgenommen. Sie hatten recht, ich war in dieser Zeit mit vielen anderen Dingen belastet und beschäftigt, sodass ich emotional nicht die Ressourcen hatte und mich selbst oft distanziert verhielt – das kommt nicht gut an. Ich habe sie von mir ferngehalten. Ich hielt mich am Stoff fest, plante genau bei der Vorbereitung, aber es funktionierte nicht, weil sie mich nicht fassen konnten. Ich war für sie nicht greifbar, ich war für sie eine anonyme Person.
Die Schüler haben mir das zurückgespiegelt, gnadenlos ... Berufsschüler sind schonungslos, vielleicht alle Schüler.
Sie haben es mir mit Worten zurückgemeldet, aber auch mit ihrer fehlenden Kooperationsbereitschaft. Arbeiten in der Klasse wurde immer schwieriger.
Aber ich habe nicht lange zugeschaut, sondern sofort Massnahmen ergriffen, ich kannte von meiner lerntherapeutischen Arbeit Methoden lösungsorientierter Gesprächsführung, Konfliktlösungsstrategien, Marshall Rosenberg usw. – das konnte ich sofort einsetzen.
Ich bin froh, dass ich damals sehr schnell reagiert habe. Heute ist das meine Lieblingsklasse, wir haben ein gutes Verhältnis. Es ist ein Vertrauensverhältnis, würde ich sagen, sie haben mich sogar gefragt, ob ich nicht ihre Klassenlehrerin werden wolle. Dazu braucht es viel.
Das heisst aber auch, dass Sie sich immer noch stark entwickeln?
Natürlich, das wird wohl hoffentlich auch nicht aufhören ...
Wie lief das denn nun mit der Ausbildung? – Sie hatten einen Job in einer Berufsschule, und dann?
Als ich zum Vorstellungsgespräch ging, hatte ich mich schon entschieden, die Ausbildung zu machen. Schon vorher hatte ich mich zum EHB-Kurs «ABU für Neueinsteiger» angemeldet. Wenn mich die Schule für Gestaltung nicht genommen hätte, hätte ich mich an anderen Schulen um eine ABU-Stelle bemüht. Ich war überzeugt, dass dies für mich ein Beruf sein könnte. Im Herbstsemester 2007 fing ich mit Unterrichten an, 2008 begann ich schon das Studium. Für mich war klar, wenn ich da einsteige, dann will ich auch die Ausbildung machen: Nägel mit Köpfen. Wenn ich etwas mache, will ich mir auch die theoretischen Grundlagen dazu erworben haben.
Am Anfang ist man erschlagen von dieser ganzen Breite der Materie, von diesem hochkomplexen Konstrukt ABU. In keinem der Länder, deren Schulsysteme ich kennenlernen durfte, ist mir etwas Komplexeres begegnet, nicht in Deutschland, wo ich eine Weile die Schule besuchte und später als Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ein Forschungsjahr an einer Universität verbrachte, nicht in der Türkei, auch nicht in Österreich, wo ich mit Begabtenförderstipendien zu Forschungsaufenthalten war.
Es ist nicht einfach, sich auf diesem Terrain zu orientieren. Es ist zu vielfältig, es möchte alles abdecken. Das ist allerdings illusorisch. Zur Arbeit am nächsten Rahmenlehrplan sollten unbedingt mehr Leute aus der Praxis beigezogen werden, nicht bloss Bildungspolitiker.
Die Gruppe der ABU-Lehrerinnen und -lehrer ist ja in einem gewissen Sinne multikulturell, im Hinblick auf die Werdegänge, da gibt es Juristen, Biologen, Germanisten, Mathematiker, Ethnologen, Anglisten usw. Diese Vielfalt ist sehr inspirierend. Alle haben sie ein Studium abgeschlossen, aber das heisst ja nun nicht, dass man auch unterrichten kann. Diese Leichtfertigkeit verstehe ich nicht so richtig. Dass man jemanden, der zwar ein Studium abgeschlossen hat, aber noch nie vor einer Klasse stand, zutraut, in einer Berufsfachschule zu unterrichten. Dort zu unterrichten, ist etwas vom Anspruchsvollsten, das kann ich vor dem Hintergrund meiner langjährigen Erfahrung sagen. Es geht ja nicht allein ums Fachliche – Fachwissen trägt einen im ABU nicht sehr weit. Man kann sich darauf nicht stützen, oder nur zum Teil. Methodik und Didaktik sind entscheidend, mit der Fachdidaktik steht und fällt es.
Das Fachwissen selbst, das kann man sich aneignen. Ich musste mir das alles auch erarbeiten, ich hatte doch keine Ahnung, wie das schweizerische politische System funktioniert, als ich in die Schweiz kam. In der Türkei kennt man die Schweiz als Land der Uhren und des Käses. Dass wir auch dasselbe Zivilgesetzbuch haben, wissen die wenigsten Türken.
Hatten Sie eigentlich einen Bezug zum dualen schweizerischen System der Berufsbildung, dieser Kombination von Schulischem und Praktischem? Zu den Betrieben?
Ich habe im ersten Jahr als ABU-Lehrerin viele Betriebe besucht, und das würde ich jeder Lehrperson empfehlen, auch den älteren. Die Betriebe verändern sich, die Technologien verändern sich, Arbeitsabläufe verändern sich, neue Maschinen werden verwendet. Wer also seit zwanzig, dreissig Jahren ABU unterrichtet, sollte unbedingt mal wieder Betriebe besuchen.
Auch die Lernenden bei der Arbeit zu sehen, hat mein Blickfeld erweitert. Sie sind dort erwachsene Personen, in der Schule verhalten sie sich weiterhin wie Schüler mit sechzehn.
Ist das nicht ein eigenartiger Graben? Man erwartet von den jungen Leuten bei der Arbeit sehr viel Selbstständigkeit, dass sie sich im Betrieb wie Erwachsene verhalten, und in der Schule werden sie in einer Art Unmündigkeit gehalten?
Die Diskrepanz ist riesig. Deswegen fühlen sie sich ja auch in den Betrieben viel wohler, weil sie dort in der Rollenfindung in dieser neuen Lebensphase mehr Spielraum haben. Das ist für sie die Perspektive, auf die sie sich hinbewegen. In der Schule setzen wir sie zurück auf die Schulbank.
Im Betrieb sind sie selbstständig, sie produzieren etwas, sie übernehmen Verantwortung. Sie sind Teil eines Ganzen, mit dem sie sich schnell identifizieren. Das «Wir», dieses «Unser Betrieb», die erste Person Plural, das kommt in ihrer Sprache sehr schnell. Und aus dieser Erwachsenenwelt müssen sie wieder ein, zwei Tage in die Schule zurück. Diese Diskrepanz führt oft auch zu paradoxen Situationen. Wir holen sie immer wieder heraus aus dem Erwachsenenleben.
Aber es kommt auch darauf an, wie man unterrichtet, aufs Unterrichtskonzept, aufs Unterrichtsverständnis. Handlungsorientierung und Unselbstständigkeit, das wäre ja ein innerer Widerspruch. Bei handlungsorientiertem Unterricht geht es genau darum, dass die Lernenden selbstständig handeln. Durch das eigene Lehrerverhalten kann man vermeiden, dass die Schüler in Unselbstständigkeit gehalten werden. Wir sollen sie ja zu selbstständigen Menschen erziehen ...
Wie machen Sie das?
Ich mache es nicht immer ... Aber der handlungsorientierte Ansatz bringt das, glaube ich, «automatisch» mit sich. Wenn sich die Lernenden Inhalte selbst erarbeiten, sind sie selbst aktiv, sie müssen selbst aktiv werden. Bei Projektarbeiten müssen sie sich den Stoff selbst aneignen. Natürlich leiste ich pädagogische Hilfestellung, ich führe sie dorthin. Aber ich präsentiere ihnen nicht fertige Mahlzeiten.
Haben Sie von Anfang an so unterrichtet?
Nein, das musste ich erst lernen. Ich musste es ausprobieren, das ABU-Studium an der Uni Zürich hat mir darin sehr geholfen und hat mir die Augen geöffnet.
Als ich ABU zu unterrichten begann, habe ich vielleicht allzu sehr auf die Eigenständigkeit der Lernenden gebaut. Wenn ich Arbeitsanweisungen gab, ging ich zu Beginn davon aus, dass sie machen würden, was ich verlangte.
Ich habe zu wenig Kontrollinstrumente eingebaut, weil ich von diesem Selbstverständnis ausging. Da stand mir vielleicht auch meine Arbeitserfahrung im Tertiärbereich im Weg. Wenn ich Studierenden einen Projektauftrag gab, war es selbstverständlich, dass sie zum vereinbarten Zeitpunkt nach den Vorgaben liefern würden. An der Uni in Istanbul hat das funktioniert. Hier, auf der Berufsschulstufe, hat es nicht mehr funktioniert. Dort war ich als Dozentin per se eine Autorität, nicht nur weil ich autoritär auftrat. Dort wird das akzeptiert, es wird sogar erwartet und gehört zum Berufsbild. Hier bin ich nicht autoritär, und es braucht Zeit, bis einem Autorität zugestanden wird, ohne dass man autoritär wäre. Die Lehrperson muss ihre Kompetenz im Fachgebiet beweisen.
Ich bin also allzu sehr von meiner eigenen Lernbiografie ausgegangen. Ich habe das Verantwortungsbewusstsein zu hoch gewichtet. Das war wohl der grösste Fehler. Diese eher zurückhaltende Art der Begleitung war in der Berufsschule nicht adäquat, ich habe zu viel erwartet, wenigstens was die Einstellung der Schüler zum Lernen anging. Ich habe sie damit überfordert. Das habe ich sehr schnell realisiert.
Woran haben Sie das gemerkt?
Die Schüler reagieren ... sie lassen die Lehrperson sehr deutlich und schnell spüren, was sie nicht wollen, da muss man gar nicht lange suchen. Dieser mangelnde Respekt, diese Protesthaltung, das kommt sehr schnell zum Ausdruck. Das ist es auch, was einen wach hält ...
Dass zum Beispiel Beurteilungskritieren hier so transparent sein müssen, das musste ich erst lernen. Beurteilungskritierien hat ein Student in Istanbul nie hinterfragt, weil ich die Autorität war, und es wäre eine Missachtung der Autorität, wenn man hinterfragen würde. Ich musste mein ganzes Lehrerverständnis umkrempeln, als ich hier in der Berufsschule anfing. Die kulturellen Differenzen sind spürbar ...
Ich habe kürzlich erst meinen Vater verloren. Und zum ersten Mal fiel mir beim Totengebet in der Moschee auf, dass in der Türkei die Seelen der toten Lehrer erwähnt werden. Man wünscht ihnen, dass sie im Paradies ihre Ruhe finden. Das ist ein Teil der Litanei des Hodschas. Man betet für den Verstorbenen, für Atatürk, und dann kommen die Lehrer, kein anderer Beruf, nur die Lehrer. Das wurde mir beim Begräbnis meines Vaters zum ersten Mal bewusst.
Atatürk hat grossen Wert darauf gelegt, dass der Lehrerberuf diesen Status bekam. Es gibt in der Türkei ja sogar einen Tag der Lehrer, am 24. November. Aber schon vor der Säkularisierung der Türkei gab es die Hodschas, die grosse Achtung genossen, sie waren unumschränkte Autoritäten. Auch autoritäres Verhalten wird in der Türkei geduldet, das gehört dazu, der Respekt gegenüber der Autorität.
In einer solchen Kultur war ich also Dozentin gewesen.
Dass mich meine Schüler hier mit Namen ansprechen, dass ich für sie einfach Frau Dal bin, daran musste ich mich erst gewöhnen. In der Türkei wird ein Lehrer nicht mit Namen angesprochen, sondern mit «Hodscham» oder «Öğretmenim», «mein Lehrer». Ich musste also umdenken.



