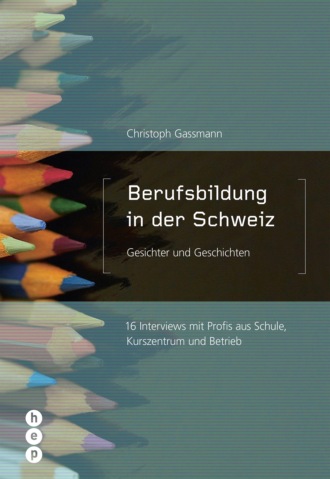
Полная версия
Berufsbildung in der Schweiz - Gesichter und Geschichten
Oder ich höre, wie die Studierenden diskutieren. Ich sehe, ob sie vielleicht teilnahmslos in der Bank hängen, nehme andere nonverbale Signale wahr ... Das sind alles Feedbacks auf mein eigenes Handeln, die ich wahrnehme und reflektiere. Manchmal gibt es auch direktes Feedback.
Zum andern gibt es nach zwei oder drei Tagen immer eine Lernergebnissicherung, da wird das Gelernte vorgezeigt. Anhand dessen sehe ich, ob geübt wurde, aber auch, ob der Unterricht gut war oder nicht. Wenn ich etwas demonstriert habe, benützen die Studierenden anschliessend beim Üben dieselben Begriffe wie ich beim Vorzeigen, das heisst ja, sie haben zugehört. Manchmal ist das fast beängstigend, wie exakt sie mich «kopieren» ...
Je jünger die Studierenden sind, desto wichtiger ist übrigens die Instruktion. Erst später sollte man loslassen, sie selber konstruieren lassen. Wo sie genau stehen, lässt sich nicht immer leicht beurteilen. Das ist für mich aber eine wichtige Frage: was die Studierenden im Augenblick brauchen. Im Skills-Training arbeiten wir stark nach dem Modell der kognitiven Meisterlehre, der Cognitive Apprenticeship.
Dass die Ausbildung nach drei Jahren nicht abgeschlossen ist, ist in unserem Beruf hingegen völlig klar. In der Pflege merkt jeder bald, dass es mit Lernen und Selbstständigsein erst nach der Ausbildung richtig losgeht. Feedbacks kommen im Pflegealltag sehr schnell. Man arbeitet ja im Team im Dreischichtenbetrieb, jeder Fehler kommt deshalb zurück. In dieser Hinsicht ist der Pflegeberuf ziemlich hart, die Kollegen müssen unsere Fehler ausbügeln und werden sie deshalb auch zurückmelden.
Bei den Lehrpersonen ist das ja in einem gewissen Sinne ähnlich. Im Studium erwerben sie auch nur eine Grundlage, die ihnen den Einstieg erlaubt – aber fertig ist die Ausbildung dann längst nicht ...
Das fand ich als junge Lehrerin recht schwierig. Man hat von mir als Einsteigerin nicht weniger erwartet als von gestandenen Lehrkräften – zumindest hatte ich diesen Eindruck. Im Kanton St. Gallen ist es auch so, dass man als Einsteigerin ohne Abschluss als Berufsfachschul-Lehrperson mehr Lektionen übernehmen muss als jemand, der ausgelernt ist, hundert Lektionen mehr pro Jahr, auf hundert Prozent gerechnet. – Das hat mir am Anfang zu denken gegeben.
In der Pflege ist das anders. Man weiss, jemand kommt frisch aus der Ausbildung, da wird nicht dasselbe verlangt wie von erfahrenen Pflegekräften. Das gilt auch für die, die neu in einer anderen Abteilung mit anderen fachspezifischen Anforderungen anfangen.
Wie ist es denn mit dem Nachwuchs in Ihrem Beruf?
Variabel, wir haben eher zu wenig Platz, zu viele Lernende ... Dabei gibt es einen gewissen Mangel an Pflegepersonal, vor allem an qualifiziertem Personal, viele arbeiten, aufgrund der strengen Arbeitsbedingungen wie Schichtarbeit usw., nicht zu hundert Prozent, etliche steigen auch wieder aus. Inzwischen gibt es bei uns viel Personal aus Deutschland, die Grenze ist ja nicht weit. Das führt manchmal zu Problemen, weil die Deutschen eine andere Ausbildung haben. Sie verfügen teilweise nicht über dieselben Kompetenzen wie Personen, die ihre Ausbildung in der Schweiz absolviert haben. Es stellt sich dann die Frage, wo man diese Leute einsetzt, welche Weiterbildung sie brauchen, um sich auf denselben Stand zu bringen.
Leiden Sie manchmal an Ihrem Beruf?
Manchmal – zum Beispiel bei den zeitlichen Spitzenbelastungen. Und generell, weil es streng ist, auch an Wochenenden muss ich mich vorbereiten. Es ist nie zu Ende, man muss sich ständig vorbereiten, reflektieren, sich weiterbilden. Das ist mit viel Stress verbunden.
Wie schützen Sie sich?
Nicht sehr gut. Der Druck ist gross, der von innen, aber auch der von aussen. Unser Lehrerteam hat hohe Ansprüche, finde ich, wobei man sich auch immer selber misst. Am effektivsten ist, wenn ich versuche, mich vor mir selbst zu schützen.
Gibt es so etwas wie Coaching?
Es gibt kollegiale Unterrichtshospitationen, im Sinne von Wissensmanagement, da besteht auch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Ich kann Kolleginnen fragen. Ansonsten rede ich gerne mit älteren Freunden, von denen ich weiss, dass sie Erfahrung haben. Das mag ich lieber als Coaching durch eine Fremdperson. Das wäre der letzte Ausweg vor dem Burn-out. Das will ich möglichst vermeiden.
Ausserdem treibe ich Sport, pflege Hobbys und Freundschaften – Sport fast schon exzessiv ... joggen, Fitness, Ausdauersport. Auch Reisen, mich mit Freunden treffen und nicht über den Beruf reden, das gibt mir den Ausgleich.
Aber ich bewege mich oft am Limit – bin Burn-out-gefährdet, das ist mir bewusst. Man hat mir das auch schon oft gesagt, dass ich mit meinem Leistungsdenken früher oder später in die Gefahrenzone geraten könnte.
Mein Vater war ganz ähnlich und ist es immer noch: sehr leistungsorientiert, immer dabei, sich weiterzubilden, vielseitig interessiert – er ist nicht das beste Vorbild im Sinne der Burn-out-Prophylaxe. Und trotzdem stelle ich bei ihm keine Symptome eines Burn-outs fest.
Was ist das denn aus Ihrer Sicht, dieses Burn-out?
Das ist nicht so klar ... Depressionen, chronische Müdigkeit ... Für mich ist es ein Burn-out, wenn ich nicht mehr weiss, wie ich die Zahnbürste halten muss, wenn ich so ausgebrannt bin, dass ich nicht mehr ohne Nachdenken funktionieren kann.
Es ist mir schon passiert, dass ich kaum mehr Schule geben mochte. Dass ich nicht mehr mochte, nicht mehr konnte. Alles war mir zu streng. Da habe ich mich mit der Abteilungsleiterin ausgesprochen – Veränderungen erreicht. Bin auch ins Wellness gegangen. Habe mich dann relativ schnell erholt, weil ich den richtigen Moment erwischt hatte. Trotzdem war das eine Grenzerfahrung, ich weiss, so weit darf ich es nicht mehr kommen lassen. Das ist mir bis jetzt auch ganz gut gelungen. Ich habe etwas gelernt. Und ich weiss ja, ich bin am richtigen Ort, die Arbeit macht mir Spass.
Wie ist es denn mit der Kreativität, die Ihnen in der Jugend so wichtig war?
Die habe ich jetzt ja. Zum Beispiel bei der Unterrichtsgestaltung, aber auch im Privaten, wenn ich etwas organisieren kann. Sicher nicht mehr im selben Ausmass wie früher, aber ich vermisse das Zeichnen zum Beispiel nicht. Bewegung war immer ebenso wichtig, das pflege ich. Grafik, wie sie heute funktioniert, alles elektronisch, das würde ich nicht mehr wollen, das wäre mir zu technisch.
Was ist für Sie Erfolg?
Wenn ich das erreicht habe, was ich will. Ohne Wenn und Aber.
Woher weiss man, was man will?
Bei mir ist das ein starkes Bauchgefühl. Nach dem SVEB wusste ich, dass es noch nicht «fertig» war, ich wusste allerdings nicht, was als Nächstes kommen würde. Dann kam der neue MAS, und ich wusste, das war’s. Jetzt ist mein Bauchgefühl: Nach dem MAS ist für mich vorerst «mal gut». Ein paar Jahre lang will ich «einfach mal arbeiten». Dann kommt wieder etwas Neues, aber in den nächsten paar Jahren mal nicht.
Während des Studiums habe ich gemerkt, dass mich das Pädagogische genauso interessiert wie die Pflege. Jetzt kann ich beide Aspekte verbinden, aber vielleicht gehe ich später mal in die pädagogisch-didaktische Richtung weiter.
War die MAS-Ausbildung, die Sie jetzt absolviert haben, Voraussetzung, um weiter zu unterrichten?
An der HF hätte ich mit dem SVEB-Zertifikat bis fünfzig Prozent unterrichten können, mehr nicht. Als ich mich entschied, ganz in die schulische Ausbildung zu wechseln, war dieser MAS, übrigens ein Pilotstudiengang, zwar nicht zwingend, solange ich im Fünfzig-Prozent-Teilpensum unterrichtete, aber ich wollte es, um mehr Sicherheit und neue Impulse zu bekommen. Es war hart, die Ausbildung berufsbegleitend zu machen. Am Anfang konnte ich den Aufwand und meine Kapazitäten auch noch nicht so richtig einschätzen. Mit der Zeit habe ich das aber gut in den Griff bekommen.
Im ersten MAS-Jahr ging es hauptsächlich um die lernpsychologischen Grundlagen und den Transfer vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln, im zweiten Jahr um Schullehrpläne und die Frage, wie ich Unterricht aufbauen muss usw. Im dritten Jahr standen dann die Lernenden im Zentrum, psychologische Aspekte, Adoleszenz. Das war zwar interessant, aber für mich, die 18-Jährige und Ältere unterrichte, nicht immer relevant. Suchtproblematiken zum Beispiel kommen zwar auch bei uns vor, aber seltener als in einer Grundbildung. Bei uns ist ein Thema wie Burn-out wichtiger.
Wir haben uns dann in Gruppen aufgeteilt – HF und Grundbildung –, dort zwar ähnliche Themen bearbeitet, nur vielleicht nicht aufs Rauchen oder Kiffen fokussiert, sondern auf den Umgang mit Stress oder ähnliche Themen.
Man wird in einem solchen Studium halt wieder zum Schüler, obwohl man selber unterrichtet, das ist schon speziell. Ich bin übrigens eine Lernende, wie ich sie als Lehrperson nicht sonderlich schätzen würde. Sobald ich den Eindruck habe, ich kenne etwas schon, beschäftige ich mich mit anderem. Wenn ich denke: Oh, spannend, kenne ich nicht, bin ich hoch aufmerksam. Aber es kann ja nicht sein, dass an einem Schultag alles neu und interessant ist. Und dann denke ich jeweils: Yvonne, du könntest dich zusammenreissen, du würdest sich über solche Studierende aufregen. Aber hmm, ich war schon immer so.
Strafaufgaben habe ich deswegen nicht häufig bekommen, aber Ermahnungen. Die Leistungen stimmten, aber beim Verhalten ... Ich bin wohl etwas unruhig, kann mich nicht so lange auf etwas konzentrieren, bin mit meinen Gedanken immer schon einen oder zwei Schritte weiter. Ich muss ständig aufpassen, dass ich einmal etwas fertig mache. Am Ende wird alles fertig ... Das schon.
Wenn ich aufmerksamer und konzentrierter wäre, könnte ich vielleicht noch etwas mehr herausholen ... Wenn ich allerdings nicht aufmerksam bin, schaut auch etwas dabei heraus, ich folge dann meinen eigenen Gedankengängen, verarbeite, konstruiere für mich.
Und was machen Sie mit Schülerinnen oder Studierenden, die so sind wie Sie?
Ich spreche es an. Ich frage, ob es etwas gibt, was sie der ganzen Klasse mitteilen möchten ... Meist reicht das, sie merken, dass das nicht geht. Auch bei mir reicht es meist, wenn man nachfragt.
Sie haben aber eigentlich etwas anderes beschrieben: Dass Sie nicht aufmerksam sind, wenn Sie etwas schon kennen oder zu kennen glauben oder wenn etwas Sie nicht interessiert. Das ist doch eine normale, auch legitime Reaktion? Natürlich muss man sich fragen, ob es sich auch wirklich so verhält, ob man es tatsächlich schon kennt ...
Ja, und das kann ich ja gar nicht einschätzen, wenn ich nicht zuhöre. – Es kann aber auch sein, dass die Studierenden überfordert sind und deshalb nicht zuhören.
Als Unterrichtende muss ich stets überlegen, wo die Studierenden stehen; wenn ich sie unterfordere, immer mit denselben Themen belästige, dann ist klar, dass sie nicht mehr zuhören mögen. Das ist ein generelles Problem in der Berufsbildung, die mangelnde Individualisierung. Auch als Lehrerin bemühe ich mich zu wenig darum. Alle Lernenden machen im Unterricht dasselbe, egal, welche Voraussetzungen und Vorkenntnisse sie mitbringen. Wir könnten viel mehr mit dem Vorwissen der Studierenden arbeiten. Man kann sie zum Beispiel vorzeigen lassen, schauen, wo es noch Korrekturen braucht und was schon gut ist.
Es ist allerdings schwierig, im Klassenverband auf jeden Einzelnen einzugehen, jedem das zu geben, was er braucht. Das braucht viel Zeit, und weil man immer wieder andere Gruppen hat, ist es noch schwieriger.
Auch Gruppenprozesse in der Ausbildung müsste man besser begleiten. Aber dadurch, dass niemand bei uns für eine Gruppe die Hauptverantwortung hat, ist es immer die einzelne Lehrperson in der konkreten Situation, die auf ein Problem reagieren muss. Aber wer begleitet und betreut den Prozess dann weiter? Das ist ein grosses Problem, für das wir noch keine Lösung haben.
Die Passion für das Andere – Stephan Leiser

Die Passion für das Andere
Stephan Leiser, ehemaliger CEO der Noser Young Professionals (Noser-Gruppe), seit 2014 selbstständiger Berater und Coach für Bildungsprojekte
Obwohl sich in der Informatikausbildung in den letzten beiden Jahrzehnten vieles auf «normale Bahnen» eingespurt hat, sind Informatiker immer noch oft Quereinsteiger. In dieser Hinsicht ist Stephan Leisers Werdegang nicht untypisch. Alles andere an Leiser mutet eher aussergewöhnlich an, auch die Firma, die er aufgebaut und drei Jahre lang geleitet hat: Die Noser Young Professionals (NYP) in Worblaufen bei Bern, wo das Gespräch im Juni 2012 stattfand, ist eine Aktiengesellschaft, die durchaus nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen funktioniert. Allerdings sind unter den neunzehn Personen, die das Unternehmen beschäftigt, nur drei Ausgelernte, die andern sind Lernende, die sich hier ihren Beruf in der Praxis aneignen.
Leiser selbst hat einst im bernischen Oberaargau eine Lehre als Elektromonteur absolviert. Nach dem HTL-Abschluss als Elektroingenieur stieg er erst als Softwareentwickler beim Druckmaschinenhersteller WIFAG in Bern ein – ohne über tiefere Kenntnisse im Programmieren zu verfügen; die eignete er sich erst im Laufe der Zeit durch Erfahrung und Studium an. Inzwischen war er allerdings längst zum Reisenden geworden, für den die Menschen und «das ganz Andere» mindestens so viel Anziehungskraft hatten wie Technologie, Maschinen und die beharrliche Entwicklung neuer Programmcodes. So stieg er nach einem längeren Auslandaufenthalt in die Lehrlingsausbildung ein und hat u. a. auch ein Psychologiestudium an einer Fachhochschule abgeschlossen. Seit 2012 ist die Noser Young Professionals um einen weiteren Standort in Zürich gewachsen und beschäftigt inzwischen sechs Ausgelernte und über vierzig Lernende. Leiser ist allerdings seit Juli 2013 wieder auf Reisen und engagiert sich in Berufsbildungsprojekten in Albanien und Kolumbien.

Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



