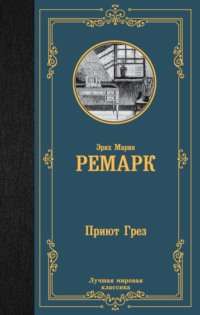Полная версия
Liebe deinen Nächsten / Возлюби ближнего своего. Книга для чтения на немецком языке
Er wirbelte das Geldstück hoch und fing es auf. Es rollte aus seiner Hand und fiel auf das Grab. Kern kletterte über die Mauer und hob es vorsichtig hoch. „Schrift! Auf deinem Grab! Du selbst rätst mir also ebenfalls dazu, Rabbi! Dann aber los!“ Er ging auf das nächste Haus zu, als wollte er eine Festung stürmen.
Im Parterre öffnete niemand. Kern wartete eine Zeitlang, dann stieg er die Treppen hinauf. In der ersten Etage kam ein hübsches Dienstmädchen heraus. Es sah seine Tasche, verzog die Lippen und machte schweigend die Tür wieder zu.
Kern stieg zur zweiten Etage empor. Nach zweimaligem Klingeln erschien dort ein Mann mit offenstehender Weste in der Tür. Kern hatte kaum angefangen zu sprechen, als der Mann ihn empört unterbrach. „Toilettewasser? Parfüm? So eine Frechheit! Können Sie nicht lesen, Mensch? Mir, dem Generalvertreter von Andrea-Parfümerieartikeln, ausgerechnet mir wagen Sie Ihren Mist anzubieten? ’raus!“
Er schmiss die Tür zu. Kern zündete ein Streichholz an und studierte das Messingschild an der Tür. Es war Tatsache; Josef Schimek handelte selbst en gros mit Parfüm, Toilettewasser und Seife. Kern schüttelte den Kopf. „Rabbi Israel Löw“, murmelte er. „Was heißt das? Sollten wir uns missverstanden haben?“
Er klingelte in der dritten Etage. Eine freundliche, dicke Frau öffnete. „Kommen Sie nur herein“, sagte sie gutmütig, als sie ihn sah. „Deutscher, nicht wahr? Flüchtling? Kommen Sie nur herein!“
Kern folgte ihr in die Küche. „Setzen Sie sich“, sagte die Frau, „Sie sind doch sicher müde.“
„Nicht sehr.“
Es war das erstemal in Prag, dass man Kern einen Stuhl anbot. Er nutzte die seltene Gelegenheit aus und setzte sich. Entschuldige, Rabbi, dachte er, ich war voreilig. Entschuldige, ich bin jung, Rabbi Israel. Dann packte er seine Tasche aus.
Die dicke Frau stand behäbig, mit über dem Magen gekreuzten Armen, vor ihm und sah ihm zu. „Ist das Parfüm?“ fragte sie und zeigte auf eine kleine Flasche.
„Ja.“ Kern hatte eigentlich erwartet, dass sie sich für Seife interessieren würde. Er hielt die Flasche hoch wie einen kostbaren Edelstein. „Das hier ist das berühmte Farr-Parfüm der Firma Kern. Etwas ganz Besonderes! Nicht so eine Lauge wie zum Beispiel die Produkte der Andreawerke, die Herr Schimek unter uns vertritt.“
„Soso…“
Kern öffnete die Flasche und ließ die Frau riechen. Dann nahm er ein Glasstäbchen und strich es über ihre fette Hand. „Versuchen Sie selbst…“
Die Frau schnupperte ihre Hand ab und nickte. „Scheint gut zu sein. Aber haben Sie nur so kleine Flaschen?“
„Hier ist eine größere. Dann habe ich noch eine, die ist sehr groß. Die hier. Sie kostet allerdings vierzig Kronen.“
„Das macht nichts. Die große ist richtig, die behalte ich.“
Kern glaubte seinen Ohren nicht trauen zu dürfen. Das waren bare achtzehn Kronen Verdienst. „Wenn Sie die große Flasche nehmen, gebe ich Ihnen noch ein Stück Mandelseife gratis dazu“, erklärte er begeistert.
„Schön, Seife kann man immer gebrauchen.“
Die Frau nahm die Flasche und die Seife und ging in ein Nebenzimmer. Kern packte inzwischen seine Sachen wieder ein. Aus der halboffenen Tür drang der Geruch von gekochtem Fleisch. Er beschloss, sich nachher ein erstklassiges Abendessen zu gönnen. Die Suppe aus der Mensa am Wenzelsplatz machte nicht satt.
Die Frau kam zurück. „Also schönen Dank und auf Wiedersehen“, sagte sie freundlich. „Hier haben Sie auch ein Butterbrot auf den Weg!“
„Danke.“ Kern blieb stehen und wartete.
„Ist noch was?“ fragte die Frau.
„Ja, natürlich,“ Kern lachte, „Sie haben mir das Geld noch nicht gegeben.“
„Das Geld? Was für Geld?“
„Die vierzig Kronen“, sagte Kern erstaunt.
„Ach so! Anton!“ rief die Frau ins Nebenzimmer hinein. „Komm doch mal her! Hier fragt einer nach Geld!“
Ein Mann in Hosenträgern kam aus dem Nebenzimmer. Er wischte sich den Schnurrbart und kaute. Kern sah, dass er über dem verschwitzten Hemd eine Hose mit Litzen trug, und eine böse Ahnung stieg plötzlich in ihm auf. „Geld?“ fragte der Mann heiser und bohrte in seinem Ohr.
„Vierzig Kronen“, erwiderte Kern. „Aber geben Sie mir lieber einfach die Flasche zurück, wenn es Ihnen zuviel ist. Die Seife können Sie dann behalten.“
„Soso!“ Der Mann kam näher heran. Er roch nach altem Schweiß und gekochtem frischem Schweinebauch. „Komm mal mit, mein Sohn!“ Er ging und öffnete die Tür zum Nebenzimmer weiter. „Kennst du das da?“ Er zeigte auf einen Uniformrock, der über einem Stuhl hing. „Soll ich das mal anziehen und mit dir zur Polizei gehen?“
Kern trat einen Schritt zurück. Er sah sich bereits vierzehn Tage im Gefängnis wegen verbotenen Handels. „Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis“, sagte er so gleichgültig, wie er konnte. „Ich kann sie Ihnen zeigen.“
„Zeig mir lieber deine Arbeitserlaubnis“, erwiderte der Mann und starrte Kern an. „Die habe ich im Hotel.“
„Dann können wir ja mal zum Hotel gehen. Oder soll die Flasche nicht doch lieber ein Geschenk sein, wie?“
„Meinetwegen.“ Kern sah sich nach der Tür um.
„Hier, nehmen Sie doch Ihr Butterbrot mit“, sagte die Frau mit breitem Lächeln.
„Danke, das brauche ich nicht.“ Kern öffnete die Tür.
„Sieh einer an! Undankbar ist er auch noch!“
Kern schlug die Tür hinter sich zu und ging rasch die Treppen hinunter. Er hörte nicht das donnernde Gelächter, das seiner Flucht folgte. „Großartig, Anton!“ prustete die Frau. „Hast du gesehen, wie er türmte? Als wenn er Bienen in der Hose hätte. Noch schneller als der alte Jude heute nachmittag. Der hat dich bestimmt für ’n Polizeihauptmann gehalten und sah sich schon im Kasten!“
Anton schmunzelte. „Haben eben alle Angst vor jeder Uniform! Selbst wenn sie einem Briefträger gehört. Unser Vorteil! Wir leben nicht schlecht von den Emigranten, was?“ Er griff der Frau an die Brüste.
„Das Parfüm ist gut.“ Sie drängte sich an ihn. „Besser als das Haarwasser von dem alten Juden heute nachmittag.“
Anton zog sich die Hose hoch. „Da schmiere dich heute Abend damit ein; dann habe ich eine Gräfin im Bett. Ist noch Fleisch im Topf?“
Kern stand auf der Straße. „Rabbi Israel Löw“, sagte er ziemlich jämmerlich zum Friedhof hinüber. „Sie haben mich ’reingelegt. Vierzig Kronen. Dreiundvierzig sogar mit dem Stück Seife. Das sind vierundzwanzig Nettoverlust.“
Er ging zum Hotel zurück. „War jemand für mich da?“ fragte er den Portier.
Der schüttelte den Kopf. „Kein Mensch.“
„Bestimmt nicht?“
„Nein. Nicht mal der Präsident der Tschechoslowakei.“
„Auf den warte ich auch nicht“, sagte Kern.
Er stieg die Treppen hinauf. Es war sonderbar, dass er von seinem Vater nichts hörte. Vielleicht war er wirklich nicht da; oder er war inzwischen von der Polizei gefasst worden.
Er beschloss, noch ein paar Tage zu warten und dann noch einmal in die Wohnung der Frau Ekowski zu gehen.
Oben in seinem Zimmer traf er den Mann, der nachts schrie. Er hieß Rabe. Er war gerade dabei sich auszuziehen.
„Wollen Sie schon zu Bett?“ fragte Kern. „Vor neun schon?“
Rabe nickte. „Es ist das Vernünftigste für mich. Ich schlafe dann bis zwölf. Das ist die Zeit, wo ich jede Nacht hochfahre. Um Mitternacht kamen sie gewöhnlich, wenn man im Bunker saß. Dann setze ich mich zwei Stunden ans Fenster. Hinterher nehme ich ein Schlafmittel. So komme ich ganz gut durch.“
Er stellte ein Glas Wasser neben sein Bett. „Wissen Sie, was mich am meisten beruhigt, wenn ich nachts am Fenster sitze? Ich sage mir Gedichte auf. Alte Gedichte aus der Schule.“
„Gedichte?“ fragte Kern erstaunt.
„Ja, ganz einfache. Zum Beispiel dieses, das man abends bei Kindern singt:
Müde bin ich, geh’ zur Ruh,Schließe meine Augen zu,Vater, lass die Augen deinÜber meinem Bette sein. Hab ich Unrecht heut getan,Sieh es, lieber Gott, nicht an.Deine Gnad und Jesu BlutMachen alle Sünden gut…“Er stand in seinem weißen Unterzeug wie ein müdes, freundliches Gespenst im halbdunklen Zimmer und sprach die Verse des Wiegenliedes langsam, mit monotoner Stimme vor sich hin, die erloschenen Augen in die Nacht vor dem Fenster gerichtet.
„Es beruhigt mich“, wiederholte er dann und lächelte. „Ich weiß nicht, wie es kommt, aber es beruhigt mich.“
„Kann sein“, sagte Kern.
„Es klingt verrückt, aber es beruhigt mich wirklich. Ich fühle mich dann still und als wäre ich irgendwo zu Hause.“
Kern wurde unbehaglich zumute. Er spürte etwas wie eine Gänsehaut. „Ich kann keine Gedichte auswendig“, sagte er. „Ich habe alles vergessen. Mir ist, als wäre es eine Ewigkeit her, seit ich in der Schule war.“
„Ich wusste es auch nicht mehr. Aber jetzt auf einmal kann ich mich an alles erinnern.“
Kern nickte. Dann stand er auf. Er wollte aus dem Zimmer ’raus. Rabe konnte dann schlafen, und er brauchte nicht mehr an ihn zu denken.
„Wenn man nur wüßte, was man abends machen soll!“ sagte er. „Abends, das ist immer das Verfluchte. Zu lesen habe ich schon lange nichts mehr. Und unten zu sitzen und zum hundertsten Male darüber zu reden, wie schön es in Deutschland war, und wann es wohl anders werden wird, dazu habe ich auch keine Lust.“
Rabe setzte sich auf sein Bett. „Gehen Sie ins Kino. Das ist das beste, um einen Abend ’rumzukriegen. Man weiß nachher nicht mehr, was man gesehen hat; aber man hat wenigstens an nichts gedacht.“
Er zog die Strümpfe aus. Kern sah ihm nachdenklich zu. „Kino“, sagte er. Ihm fiel ein, dass er vielleicht das Mädchen von nebenan dazu einladen könnte. „Kennen Sie die Leute hier im Hotel?“ fragte er.
Rabe legte die Strümpfe auf einen Stuhl und bewegte seine nackten Zehen. „Ein paar. Warum?“ Er blickte seine Zehen an, als hätte er sie noch nie gesehen.
„Hier nebenan die?“
Rabe dachte nach. „Da wohnt die alte Schimanowska. Sie war vor dem Kriege eine berühmte Schauspielerin.“
„Die meine ich nicht.“
„Er meint Ruth Holland, ein junges, hübsches Mädchen“, sagte der Mann mit der Brille, der als dritter im Zimmer wohnte. Er hatte schon eine Weile in der Tür gestanden und zugehört. Er hieß Marill und war ehemaliger Reichstagsabgeordneter. „Nicht wahr, Kern, Don Juan, so ist es doch?“
Kern errötete.
„Sonderbar“, fuhr Marill fort. „Bei den natürlichsten Sachen errötet der Mensch. Bei den gemeinen nie. Wie war das Geschäft heute, Kern?“
„Eine glatte Katastrophe. Ich habe bares Geld verloren.“
„Dann geben Sie noch was dazu. Das ist das beste Mittel, keine Komplexe zu bekommen.“
„Ich bin gerade dabei“, sagte Kern. „Ich will ins Kino gehen.“
„Bravo. Mit Ruth Holland, nehme ich an, nach Ihrer vorsichtigen Fragerei.“
„Ich weiß nicht. Ich kenne sie ja nicht.“
„Man kennt die meisten Menschen nicht. Irgendwann muss man einmal damit anfangen. Immer los, Kern. Mut ist der schönste Schmuck der Jugend.“
„Glauben Sie, dass sie mitgehen wird?“
„Natürlich. Das ist einer der Vorteile unseres beschissenen Lebens. Zwischen Angst und Langerweile ist jeder dankbar, wenn man ihn ablenkt. Also keine falsche Scham! Losgebraust und nicht gezittert!“
„Gehen Sie ins Rialto“, sagte Rabe aus seinem Bett heraus. „Da spielen sie Marokko. Ich habe gefunden, je fremder die Länder sind, desto besser wird man abgelenkt.“
„Marokko ist immer gut“, erklärte Marill. „Auch für junge Mädchen.“
Rabe packte sich seufzend in seine Decke. „Manchmal wollte ich, ich könnte zehn Jahre durchschlafen!“
„Möchten Sie dann auch zehn Jahre älter sein?“ fragte Marill.
Rabe sah ihn an. „Nein“, sagte er. „Dann wären meine Kinder ja schon erwachsen.“
* * *Kern klopfte an die Tür nebenan. Eine Stimme von drinnen antwortete etwas. Er öffnete die Tür und blieb sofort stehen. Er hatte der Schimanowska ins Auge geblickt.
Sie hatte ein Gesicht wie eine Schleiereule. Die wulstigen Falten waren dicht mit weißem Puder überdeckt und wirkten wie eine gebirgige Schneelandschaft. Tief darin, wie Löcher, saßen die schwarzen Augen. Sie starrte Kern an, als wollte sie ihm im nächsten Augenblick mit ihren Krallen ins Gesicht fliegen. In den Händen hielt sie einen zinnoberroten Schal, in dem ein paar Stricknadeln steckten. Plötzlich verzerrte sich ihr Gesicht. Kern dachte schon, sie würde auf ihn losstürzen, aber auf einmal glitt eine Art von Lächeln über ihre Züge. „Was wollen Sie, mein junger Freund?“ fragte sie mit pathetischer, tiefer Theaterstimme.
„Ich möchte mit Fräulein Holland sprechen.“ Das Lächeln verschwand wie weggewischt. „Ach so.“ Die Schimanowska blickte Kern verächtlich an und begann, heftig mit ihren Nadeln zu klappern.
Ruth Holland hockte auf ihrem Bett. Sie hatte gelesen. Kern sah, dass es das Bett war, an dem er nachts gestanden hatte. Er fühlte plötzlich eine Wärme hinter seiner Stirn. „Kann ich Sie etwas fragen?“ sagte er.
Das Mädchen stand auf und ging mit ihm auf den Korridor. Die Schimanowska ließ ihnen ein Schnauben wie von einem verwundeten Pferd folgen.
„Ich wollte Sie fragen, ob Sie mit ins Kino wollen“, sagte Kern draußen. „Ich habe zwei Karten“, log er hinzu.
Ruth Holland sah ihn an.
„Oder haben Sie etwas anderes vor? Es kann ja sein…“
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, ich habe nichts vor.“ „Dann kommen Sie doch mit! Wozu wollen Sie den ganzen Abend im Zimmer sitzen?“
„Daran bin ich schon gewöhnt.“
„Um so schlimmer. Ich war nach zwei Minuten schon froh, wieder draußen zu sein. Ich dachte, ich würde aufgefressen.“
Das Mädchen lachte. Sie wirkte plötzlich sehr kindlich. „Die Schimanowska sieht nur so aus. Sie hat ein gutes Herz.“
„Mag sein, aber das sitzt ihr nicht auf den Schultern. Der Film fängt in’einer Viertelstunde an. Wollen wir gehen?“
„Gut“, sagte Ruth Holland, und es schien, als fasse sie damit einen Entschluss.
An der Kasse ging Kern rasch voraus. „Einen Augenblick, ich hole nur die Karten ab. Sie sind hier hinterlegt.“
Er kaufte zwei Billette und hoffte, dass sie nichts gemerkt hatte. Es war ihm gleich darauf aber auch schon egal – die Hauptsache war, dass sie neben ihm saß.
Der Saal wurde dunkel. Die Kasbah[29] von Marrakesch[30] erschien auf der Leinwand, malerisch und von Sonne überflirrt, die Wüste glänzte auf, und der eintönige Klang der Flöten und Tamburine zitterte durch die heiße afrikanische Nacht…
Ruth Holland lehnte sich in ihrem Sessel zurück. Die Musik fiel über sie wie ein warmer Regen – ein warmer, eintöniger Regen, aus dem sich quälend die Erinnerung hob…
Sie stand am Burggraben von Nürnberg. Es war April. Vor ihr stand in der Dunkelheit der Student Herbert Billing, ein zerknülltes Zeitungsblatt in der Hand.
„Du verstehst, was ich meine, Ruth?“
„Ja, ich verstehe es, Herbert! Es ist leicht zu verstehen.“
Billing zerknitterte nervös das Exemplar des „Stürmer[31]“.
„Mein Name als Judenknecht in der Zeitung! Als Rassenschänder! Das ist der Ruin, verstehst du?“
„Ja, Herbert.“
„Ich muss sehen, wie ich da ’rauskomme. Meine ganze Karriere steht auf dem Spiel. In der Zeitung, das liest jeder, verstehst du?“
„Ja, Herbert. Mein Name steht auch in der Zeitung.“
„Das ist ganz was anderes! Was kann dir das ausmachen? Du darfst doch sowieso nicht mehr zur Universität.“
„Du hast recht, Herbert.“
„Also Schluss, nicht wahr? Wir sind getrennt und haben nichts mehr miteinander zu tun.“
„Nichts mehr. Und nun leb wohl.“
Sie drehte sich um und ging.
„Warte – Ruth – hör doch, einen Moment!“
Sie blieb stehen. Er kam heran. Sein Gesicht war so dicht vor ihr in der Dunkelheit, dass sie seinen Atem spürte. „Hör zu“, sagte er. „Wo gehst du jetzt hin?“
„Nach Hause.“
„Du brauchst doch nicht gleich…“ Er atmete stärker. „Es ist natürlich alles abgemacht, nicht wahr? Das bleibt dann so! Aber du könntest doch… wir könnten… gerade heute abend ist keiner bei mir zu Hause, verstehst du, und wir würden nicht gesehen.“ Er fasste nach ihrem Arm. „Wir brauchen uns ja nicht gerade so zu trennen, so formell meine ich, wir könnten doch noch einmal…“
„Geh!“ sagte sie. „Sofort!“
„Aber sei doch vernünftig, Ruth.“ Er nahm sie um die Schulter.
Sie sah das hübsche Gesicht, das sie geliebt und dem sie gedankenlos vertraut hatte. Dann schlug sie hinein. „Geh!“ schrie sie, während ihr die Tränen herunterstürzten. „Geh!“
Billing zuckte zurück. „Was? Schlagen? Mich schlagen? Du dreckige Judensau willst mich schlagen?“
Er machte Miene, sich auf sie zu stürzen.
„Geh!“ schrie sie gellend.
Er sah sich um. „Halt den Mund!“ zischte er. „Willst mir wohl noch Leute auf den Hals hetzen, was? Könnte dir so passen! Ich gehe, jawohl, ich gehe! Gott sei Dank, dass ich dich los bin!“
„Quand l’amour meurt[32]“, sang die Frau auf der Leinwand mit ihrer dunklen Stimme durch den Lärm und Rauch des marokkanischen Cafés. Ruth Holland strich sich über die Stirn.
Das andere war wenig dagegen. Die Angst der Verwandten, bei denen sie wohnte – das Drängen des Onkels, abzureisen, damit er nicht hineingezogen würde – der anonyme Brief, in dem ihr mitgeteilt wurde, wenn sie nicht in drei Tagen verschwunden sei, werde man sie auf einem Wagen, mit Schildern auf Brust und Rücken und abgeschnittenem Haar als Rassenschänderin durch die Stadt füh-ren – der Besuch am Grabe ihrer Mutter – der nasse Morgen vor dem Kriegerdenkmal, von dem man den Namen ihres Vaters, der 1916 in Flandern gefallen war, abgekratzt hatte, weil er Jude war – und dann die hastige, einsame Fahrt mit den paar Schmuckstücken ihrer Mutter über die Grenze nach Prag…
Die Flöten und Tamburine setzten auf der Leinwand wieder ein. Darüber hinweg wehte der Marsch der Fremdenlegionäre – die eiligen, erregenden Rufe der Clairons über den Kompanien der in die Wüste ziehenden Kämpfer ohne Heimat und Vaterland.
Kern beugte sich zu Ruth Holland hinüber. „Gefällt es Ihnen?“
„Ja…“
Er griff in die Tasche und schob ihr eine kleine flache Flasche hinüber. „Eau de Cologne[33]“, flüsterte er. „Es ist heiß hier. Vielleicht erfrischt es Sie etwas.“
„Danke.“
Sie schüttelte ein paar Tropfen auf ihre Hand. Kern sah nicht, dass sie plötzlich Tränen in den Augen hatte.
„Danke“, sagte sie noch einmal.
Steiner saß zu zweitenmal im Café Hellebarde. Er schob dem Kellner einen Fünfschillingschein hin und bestellte einen Kaffee.
„Telefonieren?“ fragte der Kellner.
Steiner nickte. Er hatte noch einige Male mit wechselndem Glück in anderen Lokalen gespielt und besaß jetzt etwa fünfhundert Schilling.
Der Kellner legte ihm einen Pack Journale hin und ging. Steiner griff nach einer Zeitung und begann zu lesen. Aber er legte sie bald wieder beiseite; es interessierte ihn wenig,“ was in der Welt los war. Für jemand, der unter Wasser schwamm, gab es nur eins: wieder hochzukommen… es war ihm gleich, was die Fische für Farben hatten.
Der Kellner brachte den Kaffee und stellte ein Glas Wasser dazu. „Die Herren kommen in einer Stunde.“
Er blieb am Tisch stehen. „Schönes Wetter heute, was?“ fragte er nach einiger Zeit.
Steiner nickte und starrte auf die Wand, an der eine Aufforderung hing, durch Malzbiertrinken das Leben zu verlängern.
Der Kellner schlurfte hinter die Theke zurück. Nach einiger Zeit brachte er auf einem Tablett ein zweites Glas Wasser heran.
„Bringen Sie mir lieber einen Kirsch“, sagte Steiner. „Gut. Sofort.“
„Trinken Sie auch einen mit.“
Der Kellner verbeugte sich. „Danke, mein Herr. Sie haben Verständnis für unsereins. Das findet man selten.“
„Ach wo!“ erwiderte Steiner. „Ich langweile mich nur, das ist alles.“
„Ich habe Leute gekannt, die sind schon auf schlechtere Ideen gekommen, wenn sie sich gelangweilt haben“, sagte der Kellner.
Er trank und kratzte sich die Gurgel. „Mein Herr“, sagte er dann vertraulich, „ich weiß doch, worum es sich bei Ihnen handelt – wenn ich Ihnen einen Rat geben dürfte, würde ich Ihnen den toten Österreicher empfehlen. Es gibt ja auch noch tote Rumänen, die sind sogar etwas billiger – aber wer kann schon rumänisch?“
Steiner sah ihn scharf an.
Der Kellner ließ seine Gurgel im Stich und begann, sich den Nacken zu reiben. Er kratzte dazu mit dem Fuß wie ein Hund. „Am besten wäre natürlich ein Amerikaner oder ein Engländer“, sagte er nachdenklich. „Aber wann stirbt schon mal ein Amerikaner in Österreich! Und wenn schon, vielleicht durch einen Autounfall – wie kommt man an den Pass?“
„Ich glaube, ein deutscher ist besser als ein österreichischer“, sagte Steiner. „Schlechter zu kontrollieren.“
„Das schon. Aber Sie kriegen keine Arbeitserlaubnis darauf. Nur Aufenthalt. Mit einem toten Österreicher dagegen können Sie überall in Österreich arbeiten.“
„Bis man erwischt wird.“
„Ja, natürlich! Aber wer wird in Österreich schon erwischt? Höchstens der Falsche…“
Steiner musste lachen. „Man kann auch mal der Falsche sein. Es bleibt gefährlich.“
„Ach, wissen Sie, mein Herr“, sagte der Kellner, „gefährlich soll’s auch sein, wenn man in der Nase bohrt.“
„Ja; aber darauf steht kein Zuchthaus.“
Der Kellner fing an, vorsichtig seine Nase zu massieren. Er bohrte aber nicht. „Ich meine es gut, mein Herr“, sagte er. „Ich habe hier meine Erfahrungen gesammelt. Ein toter Österreicher ist noch das Reellste.“
* * *Gegen zehn Uhr kamen die beiden Passhändler. Einer von ihnen, ein behender Mensch mit Vogelaugen, führte die Unterhaltung. Der andere saß nur massig und aufgeschwemmt dabei und schwieg.
Der Redner zog einen deutschen Pass hervor. „Wir haben uns bei unseren Geschäftsfreunden erkundigt. Sie können diesen Pass auf Ihren eigenen Namen ausgestellt bekommen. Die Personalbeschreibung wird weggewaschen und Ihre eigene eingesetzt. Bis auf den Geburtsort natürlich, da müssen Sie schon Augsburg nehmen, weil die Stempel von dort sind. Das kostet allerdings zweihundert Schilling mehr. Präzisionsarbeit, verstehen Sie?“
„Soviel Geld habe ich nicht“, sagte Steiner. „Ich lege auch keinen Wert auf meinen Namen.“
„Dann nehmen Sie ihn so. Wir ändern nur die Fotografie. Den kleinen Stempelrand, der über das Foto läuft, machen wir Ihnen gratis dazu.“
„Nützt nichts. Ich will arbeiten. Mit dem Pass da bekomme ich keine Arbeitserlaubnis.“
Der Redner zuckte die Achseln. „Dann bleibt nur der österreichische. Damit können Sie hier arbeiten.“
„Und wenn bei der Polizeibehörde angefragt wird, die ihn ausgestellt hat?“
„Wer soll anfragen? Wenn Sie nichts ausfressen?“ „Dreihundert Schilling“, sagte Steiner.
Der Redner fuhr zurück. „Wir haben feste Preise“, erklärte er beleidigt. „Fünfhundert, nicht einen Groschen darunter.“
Steiner schwieg.
„Bei dem deutschen hätte man was machen können, so was kommt öfter vor. Aber ein österreichischer ist was Rares. Wann hat ein Österreicher schon mal einen Pass? Im Lande braucht er keinen, und wann reist er schon ins Ausland? Dazu noch bei der Devisensperre! Fünfhundert ist geschenkt dafür.“
„Dreihundertfünfzig.“
Der Redner ereiferte sich. „Dreihundertfünfzig habe ich selbst der Trauerfamilie gezahlt. Was meinen Sie, was für Arbeit dazu gehört hat! Dazu die Provisionen und die Spesen. Pietät[34] ist teuer, mein Herr! So frisch vom Grabe weg was zu bekommen, da müssen Sie schön bare Pimperlinge auf den Tisch zählen! Nur bares Geld trocknet die Tränen und läßt die Trauer zurücktreten! Vierhundertfünfzig meinetwegen, gegen unsere Interessen, weil Sie uns sympathisch sind.“
Sie einigten sich auf vierhundert. Steiner zog eine Fotografie von sich aus der Tasche, die er in einem Automaten für einen Schilling hatte machen lassen. Die beiden gingen damit los, und eine Stunde später brachten sie den Pass zurück. Steiner bezahlte ihn und steckte ihn ein.
„Viel Glück!“ sagte der Redner. „Und noch einen Tip. Wenn er abgelaufen ist, können wir ihn verlängern. Datum wegwaschen und ändern. Sehr einfach. Die einzige Schwierigkeit sind die Visa. Je später Sie weiche brauchen, um so besser – desto länger kann man das Datum verschieben.“
„Das hätten wir doch jetzt schon tun können“, sagte Steiner.
Der Redner schüttelte den Kopf. „Besser für Sie so. Sie haben so einen echten Pass, den Sie gefunden haben können. Eine Fotografie auszutauschen ist nicht so schlimm, wie etwas Schriftliches zu ändern. Und Sie haben ja ein Jahr Zeit. Da kann viel passieren.“
„Hoffentlich.“
„Strenge Diskretion natürlich, nicht wahr? Unser aller Interesse. Höchstens mal eine seriöse Empfehlung. Sie kennen ja den Weg. Alsdann[35], guten Abend.“
„Guten Abend.“
„Strszecz miecze[36]“, sagte der Schweiger.
„Er spricht nicht deutsch“, grinste der Redner auf einen Blick Steiners. „Hat aber eine wunderbare Hand für Stempel. Streng seriös natürlich.“