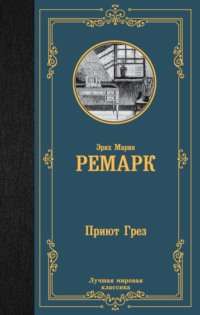Полная версия
Liebe deinen Nächsten / Возлюби ближнего своего. Книга для чтения на немецком языке
Nach einer Ewigkeit, schien ihm, nickte die Frau.
„Versprichst du es mir?“
Die Frau nickte langsam. Ihre Schultern sanken zusammen.
„Ich biege jetzt ab und komme den Gang rechts herauf. Geh links herum und komme mir entgegen. Sprich nichts, tu nichts! Ich will dich nur noch einmal sehen. Dann gehe ich. Wenn du nichts hörst, bin ich durchgekommen.“
Die Frau nickte und ging rascher.
Steiner bog ab und ging die Gasse rechts hinauf. Sie war eingesäumt von den Buden der Schlächter. Frauen mit Körben feilschten vor den Ständen. Das Fleisch glänzte blutig und weiß in der Sonne. Es roch unerträglich. Die Schlächter schrien. Aber plötzlich versank alles. Das Hacken der Beile auf den Holzklötzen wurde zum feinen Dengeln von Sensen. Eine Wiese war da, ein Kornfeld, Freiheit, Birken, Wind und der geliebte Schritt und das geliebte Gesicht. Ihre Augen fassten sich und ließen sich nicht los, und in ihnen war alles: Schmerz und Glück und Liebe und Trennung, das Leben schwankend hoch über ihren Gesichtern, voll und süß und wild, und der Verzicht, das rasende Kreisen der tausend flimmernden Messer.
Sie gingen und standen still zugleich, und sie gingen und wussten es nicht. Dann stürzte die Leere grell in Steiners Augen, und erst nach einer Weile unterschied er wieder die Farben und das Kaleidoskop, das sinnlos vor seinen Augäpfeln abrollte und nicht eindrang.
Er stolperte weiter, dann ging er rasch, so schnell er konnte, ohne aufzufallen. Er stieß die Hälfte eines geschlachteten Schweines von einem mit Wachstuch belegten Tisch, er hörte das Schimpfen des Schlächters wie das Rasseln einer Trommel, er lief um die Ecke der Budengasse und blieb stehen.
Er sah sie fortgehen vom Markt. Sie ging sehr langsam. An der Ecke der Straße blieb sie stehen und drehte sich um. So stand sie lange Zeit, das Gesicht etwas emporgehoben, die Augen weit offen. Der Wind zerrte an ihren Kleidern und drückte sie gegen ihren Körper. Steiner wusste nicht, ob sie ihn sah. Er wagte nicht, sich ihr noch einmal zu zeigen. Er ahnte, dass sie vielleicht zurücklaufen würde zu ihm. Nach einer Weile hob sie die Hände und legte sie um ihre Brüste. Sie hielt sie ihm hin. Sie hielt sich ihm hin. Sie hielt sich ihm hin in einer schmerzvoll leeren, blinden Umarmung, den Mund geöffnet, mit geschlossenen Augen. Dann wandte sie sich langsam ab, und die Schattenschlucht der Straße verschluckte sie.
Drei Tage später kam Steiner über die Grenze. Die Nacht war hell und windig, und der Mond stand kreidig am Himmel. Steiner war ein harter Mensch, aber als er die Grenze überquert hatte, nass von kaltem Schweiß, drehte er sich um und sagte wie irrsinnig in die Richtung, aus der er kam, den Namen seiner Frau.
* * *Er nahm eine neue Zigarette heraus. Kern gab ihm Feuer.
„Wie alt bist du?“ fragte Steiner.
„Einundzwanzig. Bald zweiundzwanzig.“
„So, bald zweiundzwanzig. Kein Spaß, Baby, was?“
Kern schüttelte den Kopf.
Steiner schwieg eine Zeitlang. Dann sagte er: „Mit einundzwanzig war ich im Krieg. In Flandern. War auch kein Spaß. Da ist dieses hier hundertmal besser. Verstehst du?“
„Ja.“ Kern drehte sich um. „Es ist auch besser, als tot zu sein. Das weiß ich alles.“
„Dann weißt du schon viel. Vor dem Kriege wussten nur wenige Leute so was.“
„Vor dem Kriege – das war vor hundert Jahren.“ „Vor tausend. Mit zweiundzwanzig Jahren lag ich im Lazarett. Da habe ich etwas gelernt. Willst du wissen, was?“
„Ja.“
„Schön.“ Steiner zog an seiner Zigarette. „Ich hatte nichts Besonderes. Fleischdurchschuss ohne viel Schmerzen. Aber neben mir lag mein Freund. Nicht irgendein Freund. Mein Freund.
Ein Splitter hatte ihm den Bauch aufgerissen. Er lag da und schrie. Kein Morphium, verstehst du? Hatten sogar für die Offiziere zuwenig. Am zweiten Tag war er so heiser, dass er nur noch stöhnte. Flehte mich an, ein Ende zu machen. Hätte es getan, wenn ich gewusst hätte, wie. Am dritten Tag gab’s mittags auf einmal Erbsensuppe. Dicke Friedenssuppe mit Speck. Vorher hatten wir nur so eine Art Aufwaschwasser gekriegt. Wir aßen sie. Waren furchtbar hungrig. Und während ich fraß wie ein heißhungriges Vieh, selbstvergessen mit Genuss fraß, sah ich über den Rand der Schüssel das Gesicht meines Freundes, die zerborstenen, aufgerissenen Lippen, ich sah, dass er unter Qualen starb, zwei Stunden später war er tot, und ich fraß und es schmeckte mir wie nie in meinem Leben.“
Er machte eine Pause.
„Ihr hattet eben schrecklichen Hunger“, sagte Kern.
„Nein, das war es nicht. Es war etwas anderes: dass neben dir jemand verrecken kann – und du nichts davon spürst. Mitleid, gut – aber die Schmerzen spürst du trotzdem nicht! Dein Bauch ist heil, das ist es. Einen halben Meter neben dir geht für einen andern die Welt unter in Gebrüll und Qual – und du spürst nichts. Das ist das Elend der Welt! Merk dir das, Baby. Deshalb geht es so langsam vorwärts. Und so schnell rückwärts. Glaubst du’s?“
„Nein“, sagte Kern.
Steiner lächelte. „Klar. Aber denk mal gelegentlich dran. Vielleicht hilft dir’s.“
Er stand auf. „Ich will los. Zurück. Der Zöllner glaubt nicht, dass ich jetzt kommen werde. Er hat die erste halbe Stunde aufgepasst. Morgen früh wird er wieder aufpassen. Dass ich inzwischen ’rüberrücken könnte, geht nicht in seinen Kopf. Zöllnerpsychologie. Gottlob[23] ist der Gejagte meistens nach einiger Zeit klüger als der Jäger. Weißt du warum?“
„Nein.“
„Weil für ihn mehr auf dem Spiel steht.“ Er schlug Kern auf die Schulter. „Deshalb sind die Juden das schlaueste Volk der Erde geworden. Erstes Gesetz des Lebens: Gefahr schärft die Sinne.“
Er gab Kern die Hand. Sie war groß und trocken und warm. „Mach’s gut. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ich werde abends öfter im Café Sperle sein. Kannst da nach mir fragen.“
Kern nickte.
„Also mach’s gut. Und vergiss das Kartenspielen nicht. Es lenkt ab, ohne dass man denken muss. Ein hohes Ziel für Leute ohne Bleibe. Du bist nicht schlecht in Jass und Tarock. Im Poker musst du noch mehr riskieren. Mehr bluffen.“
„Gut“, sagte Kern. „Ich werde mehr bluffen. Und ich danke dir auch. Für alles.“
„Dankbarkeit musst du dir abgewöhnen. Nein, gewöhn sie dir nicht ab. Kommst besser damit durch. Ich meine nicht bei den Leuten, das ist gleichgültig. Bei dir. Wärmt dir das Herz, wenn du’s mal sein kannst. Und denk dran: alles besser als Krieg!“
„Und besser als tot.“
„Tot weiß ich nicht. Aber besser als sterben auf jeden Fall. Servus, Baby!“
„Servus[24], Steiner!“
Kern blieb noch eine Zeitlang sitzen. Der Himmel war klar geworden und die Landschaft war voll Frieden. Sie war ohne Menschen.
Kern saß schweigend im Schatten der Buche. Das helle durchscheinende Grün der Blätter bauschte sich über ihm wie ein großes Segel – als triebe der Wind die Erde sanft durch den unendlichen blauen Raum – vorbei an den Signallichtern der Sterne und der Leuchtboje des Mondes.
Kern beschloss zu versuchen, nachts noch bis Pressburg zu kommen und von da nach Prag. Eine Stadt war immer am sichersten. Er öffnete seinen Koffer und nahm das saubere Hemd und ein Paar Strümpfe hervor, um sich umzuziehen. Er wusste, dass es wichtig war, wenn ihm jemand begegnete. Er wollte es auch, um das Gefängnis loszuwerden.
Es war ihm sonderbar zumute, als er nackt im Mondlicht dastand. Er kam sich wie ein verlorenes Kind vor. Rasch nahm er das frische Hemd, das im Grase vor ihm lag, und streifte es über. Es war ein blaues Hemd und das war praktisch, denn es schmutzte nicht so leicht. Im Mondlicht sah es fahlgrau und violett aus. Er nahm sich vor, mutig zu bleiben.
3
Kern kam nachmittags in Prag an. Er ließ seinen Koffer am Bahnhof und ging sofort zur Polizei. Er wollte sich nicht melden; er wollte nur in Ruhe nachdenken, was er tun sollte. Dazu war das Polizeigebäude der beste Platz. Dort streiften keine Polizisten umher und fragten nach Papieren. Er setzte sich auf eine Bank im Korridor. Gegenüber lag das Büro, in dem die Fremden abgefertigt wurden. „Ist der Beamte mit dem Spitzbart noch da?“ fragte er einen Mann, der neben ihm wartete.
„Ich weiß nicht. Der, den ich kenne, hat keinen.“
„Aha! Kann sein, dass er versetzt ist. Wie sind sie denn jetzt hier?“
„Es geht“, sagte der Mann. „Ein paar Tage Aufenthalt kriegt man schon. Aber nachher wird’s schwer. Es sind zu viele hier.“
Kern überlegte. Wenn er ein paar Tage Aufenthaltserlaubnis erhielt, konnte er beim Komitee für Flüchtlingshilfe für ungefähr eine Woche Eß- und Schlafkarten bekommen, das wusste er von früher her. Wenn er sie nicht bekam, riskierte er, dass man ihn einsperrte und zurück über die Grenze schob.
„Sie sind dran“, sagte der Mann neben ihm.
Kern sah ihn an. „Wollen Sie nicht vorgehen? Ich habe Zeit.“
„Gut.“
Der Mann stand auf und ging hinein. Kern beschloss abzuwarten, was mit ihm passierte, um sich dann zu entscheiden, ob er selbst hineingehen sollte oder nicht. Unruhig wanderte er auf dem Korridor hin und her. Endlich kam der Mann wieder heraus. Kern ging rasch auf ihn zu. „Wie war es?“ fragte er.
„Zehn Tage!“ Der Mann strahlte. „So ein Glück! Und ohne zu fragen. Muss gut gelaunt sein. Oder vielleicht, weil heute nicht so viele da sind. Das letztemal hatte ich nur fünf Tage.“
Kern gab sich einen Ruck. „Dann werde ich es auch versuchen.“
Der Beamte hatte keinen Spitzbart. Trotzdem kam er Kern bekannt vor. Vielleicht hatte er sich den Bart inzwischen abnehmen lassen. Er spielte mit einem zierlichen Federmesser aus Perlmutter und warf einen müden Fischblick auf Kern. „Emigrant?“
„Ja.“
„Aus Deutschland gekommen?“
„Ja. Heute.“
„Irgendwelche Papiere?“
„Nein.“
Der Beamte nickte. Er ließ die Klingen seines Messers zuschnappen und klappte den Schraubenzieher auf. Kern sah, dass in der perlmutternen Schale außerdem noch eine Nagelfeile eingelassen war. Der Beamte begann vorsichtig damit seinen Daumennagel zu glätten.
Kern wartete. Es schien ihm, als wäre der Nagel des müden Mannes vor ihm das Wichtigste auf der Welt. Er wagte kaum zu atmen, um ihn nicht zu stören und ärgerlich zu machen. Er presste nur verstohlen die Hände auf dem Rücken fest aneinander.
Der Nagel war endlich fertig. Der Beamte besah ihn befriedigt und blickte auf. „Zehn Tage“, sagte er. „Sie können zehn Tage hier bleiben. Dann müssen Sie ’raus.“
Die Spannung in Kern löste sich jäh. Er glaubte, er fiele, aber er atmete nur tief. Dann fasste er sich rasch. Er hatte gelernt, den Zufall festzuhalten. „Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn ich vierzehn Tage haben könnte“, sagte er.
„Das geht nicht. Warum?“
„Ich warte darauf, dass mir Papiere nachgeschickt werden. Dazu muss ich eine feste Adresse haben. Ich möchte dann nach Österreich.“
Kern hatte Angst, im letzten Augenblick noch alles zu verderben; aber er konnte nicht mehr zurück. Er log glatt und schnell. Er hätte ebensogern die Wahrheit gesagt, aber er wusste, dass er lügen musste. Der Beamte dagegen wusste, dass er diese Lügen glauben musste – denn es gab keine Möglichkeit, sie zu kontrollieren. So kam es, dass beide fast glaubten, von der Wahrheit zu reden.
Der Beamte ließ den Schraubenzieher seines Messers zuschnappen. „Gut“, sagte er. „Ausnahmsweise vierzehn Tage. Aber es gibt dann keine Verlängerung.“
Er nahm einen Zettel und begann zu schreiben. Kern sah ihm zu, als schriebe ein Erzengel. Er konnte kaum fassen, dass alles so geklappt hatte. Bis zum letzten Augenblick erwartete er, dass der Beamte in der Kartothek nachsehen und feststellen könnte, dass er schon zweimal in Prag war. Zur Vorsicht gab er deshalb einen anderen Vornamen und falsche Geburtsdaten an. Er konnte dann immer noch behaupten, das damalls sei ein Bruder von ihm gewesen.
Aber der Beamte war viel zu müde, um etwas nachzusehen. Er schob Kern den Zettel hin. „Hier! Sind noch mehr draußen?“
„Nein, ich glaube nicht. Vorhin wenigstens war niemand mehr da.“
„Gut.“
Der Mann zog ein Taschentuch hervor und begann liebevoll die Perlmutterschalen seines Messers zu putzen. Er merkte kaum noch, dass Kern sich bedankte und dann so rasch hinausging, als könne ihm sein Papier noch jetzt wieder abgenommen werden.
Erst draußen vor dem Tor des Gebäudes blieb er stehen und sah sich um. Du süßer Himmel, dachte er überwältigt, du süßer, blauer Himmel! Ich bin zurückgekommen und nicht eingesperrt worden! Ich brauche vierzehn Tage lang keine Angst zu haben, vierzehn volle Tage und vierzehn Nächte, eine Ewigkeit! Gott segne den Mann mit dem Perlmuttermesser! Möge er demnächst eins finden, das noch eine versenkbare Uhr und eine goldene Schere enthält.
Neben ihm vor dem Eingang stand ein Polizist. Kern fühlte nach dem Ausweis in seiner Tasche. Mit einem Entschluss trat er dann auf den Polizisten zu. „Wie spät ist es, Wachtmeister?“ fragte er.
Er hatte selbst eine Uhr bei sich. Aber es war ein zu seltenes Erlebnis, einmal vor einem Polizisten keine Angst haben zu brauchen.
„Fünf“, brummte der Polizist.
„Danke.“ Kern ging langsam die Treppe hinunter. Er wäre am liebsten gelaufen. Jetzt erst glaubte er, dass alles wirklich wahr war.
* * *Der Großraum des Komitees für Flüchtlingshilfe war überfüllt mit Menschen. Trotzdem wirkte er auf eine sonderbare Weise kahl. Die Leute standen und saßen im Halbdunkel herum wie Schatten. Fast niemand sprach. Jeder hatte alles, was ihn anging, schon hundertmal gesagt und besprochen. Jetzt gab es nur noch eins, zu warten. Es war die letzte Barriere vor der Verzweiflung.
Über die Hälfte der Anwesenden waren Juden. Neben Kern saß ein bleicher Mensch mit einem Birnenschädel, der einen Geigenkasten auf den Knien hielt. Auf der andern Seite hockte ein alter Mann, über dessen gebuckelte Stirn eine Narbe lief. Er öffnete und schloss ruhelos die Hände. Daneben saßen, eng zusammengeschmiegt, ein blonder, junger Mann und ein dunkles Mädchen. Sie hielten die Hände fest ineinander verschränkt, als fürchteten sie, wenn ihre Aufmerksamkeit nur einen Augenblick nachließe, auch hier noch auseinandergerissen zu werden. Sie sahen sich nicht an; sie sahen irgendwohin in den Raum und in die Vergangenheit hinein, und ihre Augen waren leer von Gefühl. Hinter ihnen saß eine dicke Frau, die lautlos weinte. Die Tränen liefen ihr aus den Augen, über die Wangen und das Kinn auf das Kleid; sie achtete nicht darauf und machte keinen Versuch, sie aufzuhalten. Ihre Hände lagen schlaff in ihrem Schoß.
In dieser schweigenden Ergebenheit und Trauer spielte unbefangen ein Kind. Es war ein Mädchen von ungefähr sechs Jahren. Lebhaft und ungeduldig, mit glänzenden Augen und schwarzen Locken, wanderte es umher.
Vor dem Mann mit dem Birnenschädel blieb es stehen. Es blickte ihn eine Zeitlang an; dann zeigte es auf den Kasten, den er auf den Knien hielt. „Hast du eine Geige darin?“ fragte es mit einer klingenden, fordernden Stimme.
Der Mann sah das Kind einen Moment an, als verstände er es nicht. Dann nickte er.
„Zeig sie mir“, sagte das Mädchen.
„Warum?“
„Ich möchte sie sehen.“
Der Geiger zögerte einen Augenblick; dann öffnete er den Kasten und nahm das Instrument heraus. Es war in ein violettes Seidentuch gewickelt. Mit behutsamen Händen faltete er es auseinander.
Das Kind starrte die Geige lange an. Vorsichtig hob es dann die Hand und berührte die Saiten.
„Warum spielst du nicht?“ fragte es.
Der Geiger antwortete nicht.
„Spiel doch etwas“, wiederholte das Mädchen.
„Mirjam!“ rief eine Frau, die einen Säugling auf dem Schoß hatte, von der andern Seite des Raumes leise und unterdrückt. „Komm her zu mir, Mirjam!“
Das Mädchen hörte nicht auf sie. Es schaute den Geiger an. „Kannst du nicht spielen?“
„Ich kann schon…“
„Warum spielst du dann nicht?“
Der Geiger sah sich verlegen um. Seine große, ausgearbeitete Hand umklammerte den Geigenhals. Ein paar Leute in der Nähe wurden aufmerksam und sahen ihn an. Er wusste nicht, wohin er blicken sollte.
„Ich kann doch hier nicht spielen“, sagte er schließlich.
„Warum denn nicht?“ fragte das Mädchen. „Spiel doch! Es ist langweilig hier.“
„Mirjam!“ rief die Mutter.
„Das Kind hat recht“, sagte der alte Mann mit der Narbe auf der Stirn, der neben dem Geiger saß. „Spielen Sie doch. Vielleicht lenkt es uns alle etwas ab. Und es wird ja wohl erlaubt sein.“
Der Geiger zögerte noch einen Augenblick. Dann nahm er den Bogen aus dem Kasten, spannte ihn und setzte die Geige an seine Schulter. Klar schwebte der erste Ton durch den Raum.
Es war Kern, als ob ihn etwas anrühre. Als ob eine Hand etwas in ihm wegschiebe. Er wollte sich wehren, aber er konnte es nicht. Seine Haut war dagegen. Sie fröstelte plötzlich und zog sich zusammen. Dann dehnte sie sich aus und war nichts mehr als Wärme.
Die Tür zum Büro öffnete sich. Der Kopf des Sekretärs erschien. Er kam herein und ließ die Tür hinter sich offenstehen. Sie war hell erleuchtet. Im Büro brannte schon Licht. Die kleine verwachsene Gestalt des Sekretärs hob sich dunkel von ihr ab. Es sah aus, als wollte er etwa sagen – doch dann legte er den Kopf schräg und lauschte. Langsam und lautlos, als drücke eine unsichtbare Hand gegen sie, schwang hinter ihm die Tür wieder zu.
Nur noch die Geige war da. Sie erfüllte die schwere, tote Luft des Raumes, und es schien, als verändere sich alles – als schmelze sie die stumme Einsamkeit der vielen, kleinen Existenzen, die im Schatten der Wände kauerten, und sammele sie zu einer großen gemeinsamen Sehnsucht und Klage.
Kern legte die Arme um seine Knie. Er senkte den Kopf und ließ die Flut über sich hinwegströmen. Er hatte das Gefühl, dass sie ihn wegschwemmte, irgendwohin – zu sich selbst und zu etwas sehr Fremdem. Das kleine, schwarzhaarige Mädchen hockte auf dem Boden neben dem Geiger. Es saß still und reglos und blickte ihn an.
Die Geige schwieg. Kern konnte etwas Klavier spielen, und er verstand so viel von Musik, um zu wissen, dass der Mann wunderbar gespielt hatte.
„Schumann?“ fragte der Alte neben dem Geiger.
Der nickte.
„Spiel weiter“, sagte das Mädchen. „Spiel etwas, dass man lachen kann. Hier ist es traurig.“
„Mirjam!“ rief die Mutter leise.
„Gut“, sagte der Geiger.
Er setzte den Bogen wieder an.
Kern blickte sich um. Er sah gebeugte Nacken und zurückgelegte, weiß schimmernde Gesichter, er sah Trauer, Verzweiflung und die sanfte Verklärung, die die Melodie der Geige für einige Augenblicke darüber breitete – er sah es, und er dachte an viele ähnliche Räume, die er schon gesehen hatte, angefüllt mit Ausgestoßenen, deren einziges Verschulden es war, geboren worden zu sein und zu leben. Das gab es, und diese Musik gab es zu gleicher Zeit. Es schien unbegreiflich. Es war ein unendlicher Trost und ein furchtbarer Hohn zugleich. Kern sah, dass der Kopf des Geigers auf der Geige lag wie auf der Schulter einer Geliebten. Ich will nicht untergehen, dachte er, indes die Dämmerung immer tiefer wurde in dem großen Raum, ich will nicht untergehen, das Leben ist wild und süß, ich kenne es noch nicht, es ist eine Melodie, ein Ruf, ein Schrei über fernen Wäldern, über unbekannten Horizonten, in unbekannten Nächten, ich will nicht untergehen!
Erst nach einiger Zeit merkte er, dass es still geworden war. „Was war das?“ fragte das Mädchen.
„Das waren die deutschen Tänze von Franz Schubert“, sagte der Geiger heiser.
Der alte Mann neben ihm lachte auf. „Deutsche Tänze!“ Er strich sich über die Narbe auf seiner Stirn. „Deutsche Tänze“, wiederholte er.
Der Sekretär schaltete das Licht von der Tür her an. „Der nächste…“, sagte er.
Kern bekam eine Anweisung für einen Schlafplatz im Hotel Bristol und zehn Eßkarten für die Mensa am Wenzelsplatz. Er lief fast durch die Straßen, aus Angst, dass er zu spät käme.
Er hatte sich nicht geirrt. Alle Plätze in der Mensa waren besetzt, und er musste noch warten. Unter den Essenden sah er einen seiner früheren Universitätsprofessoren. Er wollte schon auf ihn zugehen und ihn begrüßen; aber dann besann er sich und ließ es. Er wusste, dass viele Emigranten nicht an ihr früheres Leben erinnert werden wollten.
Nach einer Weile sah er den Geiger kommen und unschlüssig umherstehen. Er winkte ihm. Der Geiger sah ihn erstaunt an und kam langsam herüber. Kern wurde verwirrt. Er hatte, als er ihn wiedersah, geglaubt, den Geiger schon lange zu kennen; jetzt fiel ihm ein, dass sie noch nicht einmal miteinander gesprochen hatten.
„Entschuldigen Sie“, sagte er. „Ich habe Sie vorhin spielen hören, und ich dachte, Sie wüssten vielleicht nicht Bescheid hier.“
„Das weiß ich auch nicht. Sie?“
„Ja. Ich war schon zweimal hier. Sind Sie noch nicht lange draußen?“
„Vierzehn Tage. Ich bin heute hier angekommen.“
Kern sah, dass der Professor und jemand neben ihm aufstanden. „Da werden zwei Plätze frei“, sagte er rasch. „Kommen Sie!“
Sie drängten sich zwischen den Tischen durch. Der Professor kam ihnen durch den schmalen Gang entgegen. Er blickte Kern zweifelnd an und blieb stehen. „Kenne ich Sie nicht?“
„Ich war einer Ihrer Schüler“, sagte Kern.
„Ach so, ja…“ Der Professor nickte. „Sagen Sie, wissen Sie vielleicht Leute, die Staubsauger brauchen könnten? Mit zehn Prozent Rabatt und Ratenzahlung? Oder Grammophone mit eingebautem Radio?“
Kern war nur einen Augenblick überrascht. Der Professor war eine Autorität in der Krebsforschung gewesen. „Nein, leider nicht“, sagte er mitleidig. Er wusste, was es hieß, Staubsauger und Grammophone verkaufen zu wollen.
„Ich hätte es mir denken können.“ Der Professor sah ihn abwesend an. „Entschuldigen Sie bitte“, sagte er dann, als spräche er zu jemand ganz anderem, und ging weiter.
Es gab Graupensuppe mit Rindfleisch. Kern löffelte seinen Teller rasch leer. Als er aufschaute, saß der Geiger da, die Hände auf den Tisch gelegt, den Teller unberührt vor sich.
„Essen Sie nicht?“ fragte Kern erstaunt.
„Ich kann nicht.“
„Sind Sie krank?“ Der Birnenschädel des Geigers sah sehr gelb und farblos aus unter dem kalkigen Licht der schirmlosen Deckenlampen.
„Nein.“
„Sie sollten essen“, sagte Kern.
Der Geiger antwortete nicht. Er zündete sich eine Zigarette an und rauchte hastig. Dann schob er seinen Teller beiseite. „So kann man nicht leben!“ stieß er schließlich hervor.
Kern sah ihn an. „Haben Sie keinen Pass?“ fragte er.
„Doch. Aber…“ Der Geiger zerdrückte nervös eine Zigarette. „So kann man doch nicht leben! So ohne alles! Ohne Boden unter den Füßen!“
„Mein Gott!“ sagte Kern. „Sie haben einen Pass, und Sie haben Ihre Geige…“
Der Geiger blickte auf. „Das hat doch nichts damit zu tun“, erwiderte er gereizt. „Begreifen Sie das nicht?“
„Doch.“
Kern war maßlos enttäuscht. Er hatte geglaubt, wer so spielen konnte, müsste etwas Besonderes sein. Jemand, von dem etwas zu lernen war. Und nun sah er einen verbitterten Menschen da sitzen, der ihm, obwohl er sicher fünfzehn Jahre älter war als er, vorkam wie ein eigensinniges Kind. Erstes Stadium der Emigration, dachte er. Wird schon still werden.
„Essen Sie Ihre Suppe wirklich nicht?“ fragte er.
„Nein.“
„Dann geben Sie sie mir. Ich bin noch hungrig.“
Der Geiger schob sie ihm hin. Kern aß sie langsam auf. Jeder Löffel voll war Kraft, dem Elend zu widerstehen, und er wollte nichts davon verlieren. Dann stand er auf. „Ich danke Ihnen für die Suppe. Ich hätte lieber gehabt, Sie hätten sie selbst gegessen.“
Der Geiger sah ihn an. Sein Gesicht war von Falten zerrissen. „Das verstehen Sie noch nicht“, sagte er ablehnend.
„Das ist leichter zu verstehen, als Sie glauben“, erwiderte Kern. „Sie sind unglücklich, weiter nichts.“
„Weiter nichts?“
„Nein. Man meint anfangs, es sei etwas Besonderes. Aber Sie werden es schon merken, wenn Sie länger draußen sind. Unglück ist das Alltäglichste, was es gibt.“
Er ging hinaus. Zu seiner Verwunderung sah er draußen, auf der andern Seite der Straße, den Professor hin- und herwandern. Er hatte die charakteristische Haltung, die Hände auf dem Rücken, den Körper etwas vorgebeugt, die er annahm, wenn er vor dem Katheder auf- und abschritt, um irgendeine neue verwickelte Entdeckung auf dem Gebiet der Krebsforschung zu erläutern. Nur, dass er jetzt vielleicht an Staubsauger und Grammophone dachte.
Kern zögerte eine Sekunde. Er hätte den Professor nie angesprochen. Doch jetzt, nachdem er den Geiger gesehen hatte, ging er zu ihm hinüber.
„Herr Professor“, sagte er, „entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich Ihnen jemals einen Rat geben könnte. Aber jetzt möchte ich es tun.“
Der Professor blieb stehen. „Gerne“, erwiderte er zerstreut. „Sehr gerne. Ich bin für jeden Rat dankbar. Wie war doch Ihr Name?“