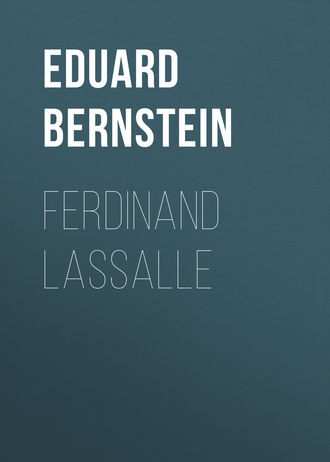
Полная версия
Ferdinand Lassalle
Wer heute die sozialpolitische Literatur des deutschen Liberalismus jener Tage wieder nachliest, dem fällt nichts so sehr auf als die kolossale Naivetät, die darin in bezug auf alle Fragen vorherrscht, die über den engen Horizont des aufgeklärten Gewürzkrämers hinausgehen. Man war sehr gebildet, sehr belesen, man wußte sehr viel von altathenischer Verfassung und englischem Parlamentarismus zu erzählen, aber die Nutzanwendung, die man aus allem zog, war immer die, daß der aufgeklärte deutsche Gewürzkrämer oder Schlossermeister der Normalmensch sei, und daß, was diesem nicht in den Kram passe, wert sei, daß es zugrunde gehe. Mit dieser selbstgefälligen Naivetät trieb man es im preußischen Abgeordnetenhaus zum Verfassungskonflikt, noch ehe man sich fest in den Sattel gesetzt, und mit dieser Naivetät entfremdete man sich die Arbeiterklasse, lange bevor ein ernsthafter Interessengegensatz dazu Veranlassung gab. Man wußte erschrecklich viel Geschichte, aber man hatte „auch wirklich nichts” aus ihr gelernt.
Auf die Ursachen und den Gegenstand des preußischen Verfassungskonflikts braucht hier nicht eingegangen zu werden. Genug, er brach aus, und der Liberalismus sah sich plötzlich, er wußte selbst nicht wie, im heftigsten Krakeel mit eben der Regierung, die er die schöne Rolle der Wiederherstellung des Deutschen Reiches zugedacht, die Hegemonie in Deutschland zugesprochen hatte. Indes das war vorläufig nur Pech, aber kein Unglück. Die liberale Partei war mittlerweile so stark geworden, daß sie den Streit eine gute Weile aushalten konnte. Dank dem bornierten Trotz ihres Widersachers hatte sie fast das ganze Volk hinter sich. Die nationale Strömung hatte alle Klassen der Bevölkerung erfaßt; von der kleinen Vetterschaft der ostelbischen Feudalen und Betbrüder abgesehen, überließen sie namentlich der inzwischen konstituierten Fortschrittspartei die Ausfechtung des Kampfes mit der preußischen Regierung. Welche Fehler diese Partei auch beging, wie gemischt auch immer ihre Elemente, wie unzulänglich auch ihr Programm, in jenem Zeitpunkt vertrat sie, gegenüber der aufs neue ihr Haupt erhebenden Koalition von Junkertum und Polizeiabsolutismus, eine Sache, bei der ihr Sieg im Interesse aller nicht feudalen Gesellschaftselemente lag: das Budgetrecht der Volksvertretung.
Aber einer Partei zeitweilig eine politische Aufgabe zuerkennen, heißt noch nicht, sich ihr mit Haut und Haaren verschreiben, ihr gegenüber auf jede Selbständigkeit verzichten. Das fühlten auch die entwickelteren Elemente unter den deutschen Arbeitern. Ihnen konnte die Rolle der Statisten, die ihnen die liberalen Wortführer zumuteten, die Kost, die ihnen in den von diesen patronisierten Bildungs- usw. Vereinen dargeboten wurde, unmöglich auf die Dauer genügen. Noch waren die alten kommunistischen und revolutionären Traditionen nicht völlig ausgestorben, noch gab es gar manchen Arbeiter, der entweder selbst Mitglied irgendeiner der kommunistischen Verbindungen gewesen oder von Mitgliedern über deren Grundsätze aufgeklärt, von ihnen mit kommunistischen Schriften versehen worden war. Unter diesen, und durch sie angeregt, fing man an, in immer weiteren Kreisen der Arbeiter die Frage zu erörtern, ob es nicht an der Zeit sei, wenn nicht sofort eine eigne Arbeiterpartei mit einem eignen Arbeiterprogramm, so doch wenigstens einen Arbeiterverband zu schaffen, der etwas mehr sei als eine bloße Kreatur der liberalen Partei.
Hätten die Herren Fortschrittler und Nationalvereinler nur ein wenig aus der Geschichte anderer Länder gelernt gehabt, es wäre ihnen ein Leichtes gewesen, zu verhindern, daß diese Bewegung sich ihnen feindselig gegenüberstellte, solange sie selbst im Kampf mit der preußischen Regierung lagen. Aber sie waren viel zu viel von dem Gefühl durchdrungen, daß sie, da sie ja die Volkssache vertraten, das „Volk”, und als „Volk der Denker” über die Einseitigkeiten – nämlich die Klassenkämpfe – des Auslandes erhaben seien; und so begriffen sie denn auch nicht, daß es sich hier um eine Strömung handelte, die früher oder später eintreten mußte, und daß es nur darauf ankam, sich mit ihr auf eine verständige Weise auseinanderzusetzen. So verliebt waren sie in sich, daß sie gar nicht zu fassen vermochten, daß die Arbeiter noch nach mehr geizen konnten, als nach der Ehre, durch sie vertreten zu sein. Die Antwort auf das Gesuch, den Arbeitern die Eintrittsbedingungen in den Nationalverein zu erleichtern: „Die Arbeiter sollen sich als die geborenen Ehrenmitglieder des Vereins betrachten” – d. h. hübsch draußen bleiben – war in der Tat typisch für das Unvermögen der Parteigenossen des braven Schulze, etwas anderes zu begreifen, als den denkenden Spießbürger – ihr Ebenbild, ihren Gott.
So kam es unter anderem zu jenen Diskussionen in Leipziger Arbeiterversammlungen, deren Ergebnis die Bildung eines Komitees zur Einberufung eines Kongresses deutscher Arbeiter und in weiterer Folge die Anknüpfung von Verhandlungen mit Ferdinand Lassalle war.
Lassalles Jugend, der Hatzfeldt-Prozeß, die Assisenrede und der Franz von Sickingen
Als das Leipziger Komitee sich an Lassalle wandte, stand dieser in seinem 37. Lebensjahre, in der Vollkraft seiner körperlichen und geistigen Entwicklung. Er hatte bereits ein bewegtes Leben hinter sich, sich politisch und wissenschaftlich – beides allerdings zunächst innerhalb bestimmter Kreise – einen Namen gemacht, er unterhielt Verbindungen mit hervorragenden Vertretern der Literatur und Kunst, verfügte über ansehnliche Geldmittel und einflußreiche Freunde – kurz, nach landläufigen Begriffen konnte ihm das Komitee, eine aus bisher völlig unbekannten Persönlichkeiten zusammengesetzte Vertretung einer im Embryozustand befindlichen Bewegung, nichts bieten, was er nicht schon hatte. Trotzdem ging er mit der größten Bereitwilligkeit auf dessen Wünsche ein und traf die einleitenden Schritte, der Bewegung diejenige Richtung zu geben, die seinen Ansichten und Zwecken am besten entsprach. Von anderen Rücksichten abgesehen, zog ihn gerade der Umstand besonders zu ihr hin, daß die Bewegung noch keine bestimmte Form angenommen hatte, daß sie sich ihm als eine ohne Schwierigkeit zu modelnde Masse darstellte. Ihr erst Form zu geben, sie zu einem Heerbann in seinem Sinne zu gestalten, das entsprach nicht nur seinen hochfliegenden Plänen, das war überhaupt eine Aufgabe, die seinen natürlichen Neigungen ungemein sympathisch sein mußte. Die Einladung traf ihn nicht nur bei seiner sozialistischen Überzeugung, sondern auch bei seinen Schwächen. Und so ging er denn mit großer Bereitwilligkeit auf sie ein.
Die vorliegende Arbeit beansprucht nicht, eine eigentliche Biographie Ferdinand Lassalles zu geben, die sehr ansehnliche Zahl der Lebensbeschreibungen des Gründers des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins noch um eine weitere zu vermehren. Der für sie zur Verfügung stehende Raum gebietet von vielem abzusehen, was zu einer Biographie gehörte. Was sie in erster Reihe will, ist vielmehr die Persönlichkeit und Bedeutung Ferdinand Lassalles zu schildern, insoweit seine politisch-literarische und agitatorische Tätigkeit in Betracht kommt. Nichtsdestoweniger ist ein Rückblick auf den Lebenslauf Lassalles unerläßlich, da er erst den Schlüssel zum Verständnis seines politischen Handelns liefert.
Schon seine Abstammung scheint auf die Entwicklung Lassalles eine große, man kann sogar sagen verhängnisvolle Wirkung ausgeübt zu haben. Wir sprechen hier nicht schlechthin von vererbten Eigenschaften oder Dispositionen, sondern von der bedeutungsvollen Tatsache, daß das Bewußtsein, von jüdischer Herkunft zu sein, Lassalle eingestandenermaßen noch in vorgeschrittenen Jahren peinlich war, und daß es ihm trotz seines eifrigen Bemühens oder vielleicht gerade wegen dieses Bemühens nie gelang, sich tatsächlich über seine Abstammung hinwegzusetzen, eine innerliche Befangenheit loszuwerden. Aber man darf nicht vergessen, daß Lassalles Wiege im östlichen Teil der preußischen Monarchie gestanden hatte – er wurde am 11. April 1825 in Breslau geboren – , wo bis zum Jahre 1848 die Juden nicht einmal formell völlig emanzipiert waren. Die Wohlhabenheit seiner Eltern ersparte Lassalle viele Widerwärtigkeiten, unter denen die ärmeren Juden damals zu leiden hatten, aber sie schützte ihn nicht vor den allerhand kleinen Kränkungen, denen die Angehörigen jeder für untergeordnet gehaltenen Rasse, auch wenn sie sich in guter Lebensstellung befinden, ausgesetzt sind, und die in einer so selbstbewußten Natur, wie Lassalle von Jugend auf war, zunächst einen trotzigen Fanatismus des Widerstandes erzeugen, der dann später oft in das Gegenteil umschlägt. Wie stark dieser Fanatismus bei dem jungen Lassalle war, geht aus seinem durch Paul Lindau zur Veröffentlichung gebrachten Tagebuch aus den Jahren 1840 und 1841 hervor. Am 1. Februar 1840 schreibt der noch nicht 15 Jahre alte Ferdinand in sein Tagebuch:
„… Ich sagte ihm dies, und in der Tat, ich glaube, ich bin einer der besten Juden, die es gibt, ohne auf das Zeremonialgesetz zu achten. Ich könnte, wie jener Jude in Bulwers ‚Leila’ mein Leben wagen, die Juden aus ihrer jetzigen drückenden Lage zu reißen. Ich würde selbst das Schafott nicht scheuen, könnte ich sie wieder zu einem geachteten Volke machen. O, wenn ich meinen kindischen Träumen nachhänge, so ist es immer meine Lieblingsidee, an der Spitze der Juden mit den Waffen in der Hand sie selbständig zu machen.” Die Mißhandlungen der Juden in Damaskus im Mai 1840 entlocken ihm den Ausruf: „Ein Volk, das dies erträgt, ist schrecklich, es räche oder dulde die Behandlung.” Und an den Satz eines Berichterstatters: „Die Juden dieser Stadt erdulden Grausamkeiten, wie sie nur von diesen Parias der Erde ohne furchtbare Reaktion ertragen werden können”, knüpft er die von Börne übernommene Betrachtung an: „Also sogar die Christen wundern sich über unser träges Blut, daß wir uns nicht erheben, nicht lieber auf dem Schlachtfeld, als auf der Tortur sterben wollen. Waren die Bedrückungen, um deren willen sich die Schweizer einst erhoben, größer?.. Feiges Volk, du verdienst kein besseres Los.” Noch leidenschaftlicher äußert er sich einige Monate später (30. Juli): „Wieder die abgeschmackten Geschichten, daß die Juden Christenblut brauchten. Dieselbe Geschichte, wie in Damaskus, auch in Rhodos und Lemberg. Daß aber aus allen Winkeln der Erde man mit diesen Beschuldigungen hervortritt, scheint mir anzudeuten, daß die Zeit bald reif ist, in der wir in der Tat durch Christenblut uns helfen werden. Aide-toi et le ciel t'aidera. Die Würfel liegen, es kommt auf den Spieler an.”
Diese kindischen Ideen verfliegen, je mehr sich der Blick erweitert, aber die Wirkung, die solche Jugendeindrücke auf die geistigen Dispositionen ausüben, bleibt. Zunächst wurde der frühreife Lassalle durch den Stachel der „Torturen”, von denen er schreibt, um so mehr angetrieben, sich für seine Person um jeden Preis Anerkennung und Geltung zu verschaffen. Auf der anderen Seite wird der Rebell gegen die Unterdrückung der Juden durch die Christen bald politischer Revolutionär. Dabei macht er einmal, als er Schillers Fiesko gesehen, folgende, von merkwürdig scharfer Selbstkritik zeugende Bemerkung: „Ich weiß nicht, trotzdem ich jetzt revolutionär-demokratisch-republikanische Gesinnungen habe wie einer, so fühle ich doch, daß ich an der Stelle des Grafen Lavagna ebenso gehandelt und mich nicht damit begnügt hätte, Genuas erster Bürger zu sein, sondern nach dem Diadem meine Hand ausgestreckt hätte. Daraus ergibt sich, wenn ich die Sache bei Lichte betrachte, daß ich bloß Egoist bin. Wäre ich als Prinz oder Fürst geboren, ich würde mit Leib und Leben Aristokrat sein. So aber, da ich bloß ein schlichter Bürgerssohn bin, werde ich zu seiner Zeit Demokrat sein.”
Sein politischer Radikalismus ist es auch, der 1841 den sechzehnjährigen Lassalle veranlaßt, den vorübergehend gefaßten Entschluß, sich zum Kaufmannsberuf vorzubereiten, wieder aufzugeben und von seinem Vater die Erlaubnis zu erwirken, sich zum Universitätsstudium vorzubereiten. Die lange Zeit verbreitete Anschauung, als sei Lassalle von seinem Vater wider seinen Willen auf die Handelsschule nach Leipzig geschickt worden, ist durch das Tagebuch als durchaus falsch erwiesen, Lassalle hat selbst seine Übersiedelung vom Gymnasium auf die Handelsschule betrieben. Freilich nicht aus vorübergehender Vorliebe für den Kaufmannsberuf, sondern um den Folgen einer Reihe von leichtsinnigen Streichen zu entgehen, die er zu dem Zweck begangen hatte, seinem Vater nicht die tadelnden Zensuren zeigen zu müssen, welche er – nach seiner Ansicht unverdient – zu erhalten pflegte. Als es ihm aber auf der Leipziger Handelsschule nicht besser erging als auf dem Breslauer Gymnasium, als er auch dort mit den meisten der Lehrer, und vor allem mit dem Direktor in Konflikte geriet, die sich immer mehr zuspitzten, je radikaler Lassalles Ansichten wurden, da war's auch sofort mit der Kaufmannsidee bei ihm vorbei. Im Mai 1840 hat er die Handelsschule bezogen, und schon am 3. August „hofft” er, daß der „Zufall” ihn eines Tages aus dem Kontor herausreißen und auf einen Schauplatz werfen werde, auf dem er öffentlich wirken könne. „Ich traue auf den Zufall und auf meinen festen Willen, mich mehr mit den Musen als den Haupt- und Strazzabüchern, mich mehr mit Hellas und dem Orient, als mit Indigo und Runkelrüben, mehr mit Thalien und ihren Priestern, als mit Krämern und ihren Kommis zu beschäftigen, mich mehr um die Freiheit, als um die Warenpreise zu bekümmern, heftiger die Hunde von Aristokraten, die dem Menschen sein erstes, höchstes Gut wegnehmen, als die Konkurrenten, die den Preis verschlechtern, zu verwünschen.” „Aber beim Verwünschen soll's nicht bleiben,” setzt er noch hinzu. Zu dem Radikalismus kommt der immer stärkere Drang, den Juden in sich abzuschütteln, und dieser Drang ist schließlich so energisch, daß, als Lassalle im Mai 1841 dem Vater seinen „unwiderruflichen” Entschluß mitteilt, doch zu studieren, er zugleich ablehnt, Medizin oder Jura zu studieren, weil „der Arzt wie der Advokat Kaufleute sind, die mit ihrem Wissen Handel treiben”. Er aber wolle studieren „des Wirkens wegen”. Mit dem letzteren war der Vater zwar nicht einverstanden, er willigte aber ein, daß Lassalle sich zum Studium vorbereite.
Nun arbeitete Lassalle mit Rieseneifer, und war im Jahre 1842 schon so weit, sein Maturitätsexamen abzulegen. Er studiert zuerst Philologie, geht aber dann zur Philosophie über und entwirft den Plan zu einer größeren philologisch-philosophischen Arbeit über den Philosophen Herakleitos von Ephesus. Daß er sich gerade diesen Denker zum Gegenstand der Untersuchung auswählte, von dem selbst die größten Philosophen Griechenlands bekannt hatten, daß sie nie sicher seien, ob sie ihn ganz richtig verstanden, und der deshalb den Beinamen „der Dunkle” erhielt, ist wiederum in hohem Grade bezeichnend für Lassalle. Mehr noch als die Lehre Heraklits, den Hegel selbst als seinen Vorläufer anerkannt hatte, reizte ihn das Bewußtsein, daß hier nur durch glänzende Leistungen Lorbeeren zu erlangen waren. Neben dem schon erwähnten Trieb, jedermann durch außergewöhnliche Leistungen zu verblüffen, hatte Lassalle zugleich das Bewußtsein, jede Aufgabe, die er sich stellte, auch lösen zu können. Dieses grenzenlose Selbstvertrauen war das Fatum seines Lebens. Es hat ihn in der Tat Dinge unternehmen und zu Ende führen lassen, vor denen tausend andere zurückgeschreckt wären, selbst wenn sie über die intellektuellen Fähigkeiten Lassalles verfügt hätten, es ist aber auf der andern Seite zum Anlaß verhängnisvoller Fehlgriffe und schließlich zur Ursache seines jähen Endes geworden.
Nach vollendetem Studium ging Lassalle 1845 an den Rhein und später nach Paris, teils um dort in den Bibliotheken zu arbeiten, teils um die Weltstadt, das Zentrum des geistigen Lebens der Epoche, kennenzulernen. In Paris gingen damals die Wogen der sozialistischen Bewegung sehr hoch, und so zog es auch Lassalle dorthin, der 1843 schon sein sozialistisches Damaskus gefunden hatte. Ob und inwieweit Lassalle mit den in Paris lebenden deutschen Sozialisten bekannt wurde – Karl Marx war, nachdem die „Deutsch-französischen Jahrbücher” eingegangen und der „Vorwärts” sistiert worden war, im Januar 1845 aus Paris ausgewiesen worden und nach Brüssel übersiedelt – , darüber fehlen zuverlässige Angaben. Wir wissen nur, daß er viel mit Heinrich Heine verkehrte, an den er empfohlen war, und dem er in mißlichen Geldangelegenheiten (einem Erbschaftsstreit) große Dienste leistete. Die Briefe, in denen der kranke Dichter dem zwanzigjährigen Lassalle seine Dankbarkeit und Bewunderung aussprach, sind bekannt. Sie lassen unter anderem erkennen, welch starken Eindruck Lassalles Selbstbewußtsein auf Heine gemacht hat.
Nach Deutschland zurückgekehrt, machte Lassalle im Jahre 1846 die Bekanntschaft der Gräfin Sophie von Hatzfeldt, die sich seit Jahren vergeblich bemühte, von ihrem Manne, einem der einflußreichsten Aristokraten, der sie allen Arten von Demütigungen und Kränkungen ausgesetzt hatte, gesetzliche Scheidung und Herausgabe ihres Vermögens zu erlangen. Man hat über die Motive, welche Lassalle veranlaßten, die Führung der Sache der Gräfin zu übernehmen, vielerlei Vermutungen aufgestellt. Man hat sie auf ein Liebesverhältnis mit der zwar nicht mehr jugendlichen, aber noch immer schönen Frau zurückführen wollen, während Lassalle selbst sich im Kassettenprozeß mit großer Leidenschaftlichkeit dagegen verwahrt hat, durch irgendeinen anderen Beweggrund dazu veranlaßt worden zu sein, als den des Mitleids mit einer verfolgten, von allen helfenden Freunden verlassenen Frau, dem Opfer ihres Standes, dem Gegenstand der brutalen Verfolgungen eines übermütigen Aristokraten. Es liegt absolut kein Grund vor, dieser Lassalleschen Beteuerung nicht zu glauben. Ob nicht Lassalle in den folgenden Jahren vorübergehend in ein intimeres Verhältnis als das der Freundschaft zur Gräfin getreten ist, mag dahingestellt bleiben; es ist aber schon aus psychologischen Gründen unwahrscheinlich, daß ein solches Verhältnis gleich am Anfang ihrer Bekanntschaft, als Lassalle den Prozeß übernahm, bestanden habe. Viel wahrscheinlicher ist es, daß neben der vielleicht etwas romantisch übertriebenen, aber doch durchaus anerkennenswerten Parteinahme für eine verfolgte Frau und dem Haß gegen den hochgestellten Adligen gerade das Bewußtsein, daß es sich hier um eine Sache handelte, die nur mit Anwendung außergewöhnlicher Mittel und Kraftentfaltung zu gewinnen war, einen großen Reiz auf Lassalle ausgeübt hat. Was andere abgeschreckt hätte, zog ihn unbedingt an.
Er hat in dem Streit gesiegt, er hat den Triumph gehabt, daß der hochmütige Aristokrat vor ihm, dem „dummen Judenjungen” kapitulieren mußte. Aber er ist gleichfalls nicht unverletzt aus dem Kampf hervorgegangen. Um ihn zu gewinnen, hatte er freilich außergewöhnliche Mittel aufwenden müssen, aber es waren nicht, oder richtiger, nicht nur die Mittel außergewöhnlicher Vertiefung in die rechtlichen Streitfragen, außergewöhnlicher Schlagfertigkeit und Schärfe in der Widerlegung der gegnerischen Finten; es waren auch die außergewöhnlichen Mittel des unterirdischen Krieges: die Spionage, die Bestechung, das Wühlen im ekelhaftesten Klatsch und Schmutz. Der Graf Hatzfeldt, ein gewöhnlicher Genußmensch, scheute vor keinem Mittel zurück, seine Ziele zu erreichen, und um seine schmutzigen Manöver zu durchkreuzen, nahm die Gegenseite zu Mitteln ihre Zuflucht, die nicht gerade viel sauberer waren. Wer die Aktenstücke des Prozesses nicht gelesen, kann sich keine Ahnung machen von dem Schmutz, der dabei aufgewühlt und immer wieder herangeschleppt wurde, von der Qualität der beiderseitigen Anklagen und – Zeugen.
Und von den Rückwirkungen der umgekehrten Augiasarbeit im Hatzfeldt-Prozeß hat sich Lassalle nie ganz freimachen können. Wir meinen das nicht im spießbürgerlichen Sinne, etwa im Hinblick auf seine späteren Liebesaffären, sondern mit Bezug auf seine von nun an wiederholt bewiesene Bereitwilligkeit, jedes Mittel gutzuheißen und zu benutzen, das ihm für seine jeweiligen Zwecke dienlich erschien; wir meinen den Verlust jenes Taktgefühls, das dem Mann von Überzeugung selbst im heftigsten Kampfe jeden Schritt verbietet, der mit den von ihm vertretenen Grundsätzen in Widerspruch steht, wir meinen die von da an wiederholt und am stärksten in der tragischen Schlußepisode seines Lebens sich offenbarende Einbuße an gutem Geschmack und moralischem Unterscheidungsvermögen. Als jugendlicher Enthusiast hatte Lassalle sich in den Hatzfeldtschen Prozeß gestürzt, – er selbst gebraucht in der Kassettenrede das Bild des Schwimmers: „Welcher Mensch, der ein starker Schwimmer ist, sieht einen andern von den Wellen eines Stromes fortgetrieben, ohne ihm Hilfe zu bringen? Nun wohl, für einen guten Schwimmer hielt ich mich, unabhängig war ich, so sprang ich in den Strom” – gewiß, aber leider war es ein recht trüber Strom, in den er sich gestürzt, ein Strom, der sich in eine große Pfütze verlief, und als Lassalle herauskam, war er von der eigenartigen Moral der Gesellschaft, mit der er sich zu befassen gehabt, angesteckt. Seine ursprünglichen besseren Instinkte kämpften lange gegen die Wirkungen dieses Giftes, drängten sie auch wiederholt siegreich zurück, aber schließlich ist er ihnen doch erlegen. Das hier Gesagte mag manchem zu scharf erscheinen, aber wir werden im weiteren Verlauf unserer Skizze sehen, daß es nur gerecht gegen Lassalle ist. Wir haben hier keine Apologie zu schreiben, sondern eine kritische Darstellung zu geben, und das erste Erfordernis einer solchen ist, die Wirkungen aus den Ursachen zu erklären1.
Bevor wir jedoch weitergehen, haben wir zunächst noch der Rolle zu gedenken, die Lassalle im Jahre 1848 gespielt hat.
Beim Ausbruch der März-Revolution war Lassalle so tief in den Maschen des Hatzfeldtschen Prozesses verwickelt, daß er sich ursprünglich fast zur politischen Untätigkeit verurteilt sah. Im August 1848 fand der Prozeß wegen „Verleitung zum Kassettendiebstahl” gegen ihn statt und er hatte alle Hände voll zu tun, sich auf diesen zu rüsten. Erst als er nach siebentägiger Verhandlung freigesprochen worden war, gewann er wieder Zeit, an den politischen Ereignissen jener bewegten Zeit direkten Anteil zu nehmen.
Lassalle, der damals in Düsseldorf, der Geburtsstadt Heines, lebte, stand natürlich als Republikaner und Sozialist auf der äußersten Linken der Demokratie. Organ dieser im Rheinland war die von Karl Marx redigierte „Neue Rheinische Zeitung”. Karl Marx gehörte ferner eine Zeitlang dem Kreisausschuß der rheinischen Demokraten an, der in Köln seinen Sitz hatte. So war eine doppelte Gelegenheit gegeben, Lassalle in nähere Verbindung mit Marx zu bringen. Er verkehrte mündlich und schriftlich mit dem erwähnten Kreisausschuß, sandte wiederholt Mitteilungen und Korrespondenzen an die „Neue Rheinische Zeitung” und erschien auch gelegentlich selbst auf der Redaktion dieses Blattes. So bildete sich allmählich ein freundschaftlicher persönlicher Verkehr zwischen Lassalle und Marx heraus, der auch später noch, als Marx im Exil lebte, in Briefen und auch zweimal in Besuchen fortgesetzt wurde. Lassalle besuchte Marx 1862 in London, nachdem Marx im Jahre 1861 auf einer Reise nach Deutschland Lassalle in Berlin besucht hatte. Indes herrschte zu keiner Zeit ein tieferes Freundschaftsverhältnis zwischen den beiden, dazu waren schon ihre Naturen viel zu verschieden angelegt. Was sonst noch einer über die politische Kampfgenossenschaft hinausgehenden Intimität im Wege stand, soll später erörtert werden.
Der hereinbrechenden Reaktion des Jahres 1848 gegenüber nahm Lassalle genau dieselbe Haltung ein, wie die Redaktion der „Neuen Rheinischen Zeitung” und die Partei, die hinter dieser stand. Gleich ihr forderte er, als die preußische Regierung im November 1848 den Sitz der Nationalversammlung verlegt, die Bürgerwehr aufgelöst und den Belagerungszustand über Berlin verhängt hatte, und die Nationalversammlung ihrerseits mit der Versetzung des Ministeriums in Anklagezustand, sowie mit der Erklärung geantwortet hatte, daß dieses Ministerium nicht berechtigt sei, Steuern zu erheben, zur Organisierung des bewaffneten Widerstandes gegen die Steuererhebung auf. Gleich dem Ausschuß der rheinischen Demokraten ward auch Lassalle wegen Aufreizung zur Bewaffnung gegen die königliche Gewalt unter Anklage gestellt, gleich ihm von den Geschworenen freigesprochen, aber die immer rücksichtsloser auftretende Reaktion stellte außerdem gegen Lassalle noch die Eventualanklage, zur Widersetzlichkeit gegen Regierungsbeamte aufgefordert zu haben, um ihn vor das Zuchtpolizeigericht zu bringen. Und in der Tat verurteilte dieses – die Regierung kannte unzweifelhaft ihre Berufsrichter – Lassalle schließlich auch zu sechs Monaten Gefängnis.
Lassalles Antwort auf die ersterwähnte Anklage ist unter dem Titel „Assisen-Rede” im Druck erschienen. Sie ist jedoch nie wirklich gehalten worden, und alles, was in verschiedenen älteren Biographien über den „tiefen” Eindruck erzählt wird, den sie auf die Geschworenen und das Publikum gemacht habe, gehört daher in das Bereich der Fabel. Lassalle hatte die Rede noch vor der Verhandlung in Druck gegeben, und da einzelne der fertigen Druckbogen auch vorher in Umlauf gesetzt worden waren, beschloß der Gerichtshof, die Öffentlichkeit auszuschließen. Als trotz Lassalles Protest und der Erklärung, die Verbreitung der Druckbogen sei ohne sein Vorwissen erfolgt, ja höchstwahrscheinlich von seinen Feinden durch das Mittel der Bestechung veranlaßt worden, der Gerichtshof den Beschluß aufrecht erhielt, verzichtete Lassalle überhaupt darauf, sich zu verteidigen, wurde aber nichtsdestoweniger freigesprochen.

