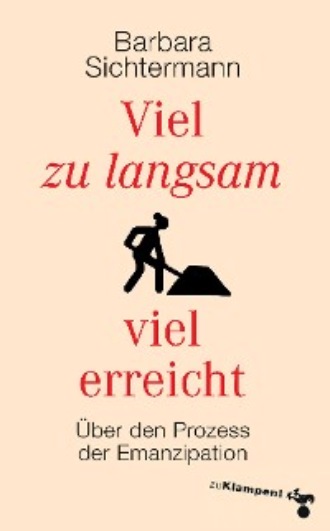
Полная версия
Viel zu langsam viel erreicht
Man darf davon ausgehen, dass der Großteil unserer Öffentlichkeit und ihrer dienstbaren Geister, die Presse, das Fernsehen, das Internet und alle sozialen und asozialen Medien, dazu auch bereit und mit diesem Auftrag unterwegs sind. Die Prioritäten, die gesetzt werden, müssen von Fall zu Fall diskutiert werden. Dieser Essay möchte herausarbeiten, warum es eben doch unumgänglich ist, die Auflehnung gegen Spielarten fortwirkender Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes fortzusetzen, auch wenn es mühselig ist und obsolet erscheint. Dass es für die jetzt lebenden Generationen nicht infrage kommen wird zu sagen: Wir haben es geschafft, es ist alles gut. Dafür ist das historische Paket an Chauvinismus, Unterdrückungs-, Widerstands- und auch Kompromissvarianten, das wir alle schultern, zu groß. Und dafür ist das Feld, in das die geschlechtsspezifische Repression hineinwirkt, zu unübersichtlich. Es ist eben viel mehr und auch etwas anderes als Gleichheit, was wir anstreben, wenn wir weibliche Freiheit meinen. Es ist ein Lebensraum frei von Herrschaft für beide Geschlechter, wobei sich die Frage einschleicht, was nicht nur Gleichheit, sondern auch, was Differenz in und außerhalb von politischen, juristischen und sozialen Bezügen als Kategorien ausrichten können.
Die Verschiedenheit der Individuen soll sich entfalten können, diesen Grundsatz halten alle modernen Gesellschaften hoch. Aber wie sieht es mit der Verschiedenheit der Geschlechter aus? Sie zu diskutieren, ohne implizit den Herrschaftsanspruch des männlichen Geschlechtes und damit die patriarchalische Gehorsamskultur mit einfließen zu lassen, war immer ein schwieriges Unterfangen und ist es geblieben. Es geht damit nur zögerlich voran. Der feministische Diskurs heute scheut davor zurück, die anstrengende und verfängliche Debatte um die Verschiedenheit der Geschlechter bei Betonung des Gleichheitsprogramms im Sinne der Emanzipation weiterzuführen. Er weicht ihr aus, weil er fürchtet, dass alles, was argumentativ vom Pfad der Gleichheit abweicht, zu Rückschritten führt. Die Flucht in die verschiedenen Transgender-Diskussionen, die ein gedankliches Feld beackern, in dem die Existenz von Geschlechtern überhaupt infrage steht, ist ein Beispiel für diese tiefsitzende Furcht. Frau sollte aber das Risiko eingehen, über die Verschiedenheit der Geschlechter nachzudenken, und sich den Konsequenzen stellen. Zu denen muss nicht gehören, dass gleiche Rechte im Sinne von gleichen Chancen und Bedingungen verloren gehen. Im Gegenteil, da der Sinn der Zweigeschlechtlichkeit bei der Spezies Homo sapiens in der Verschiedenheit der beiden Geschlechter liegt, was ihre generativen Potenzen und womöglich noch einige andere Bereiche betrifft, könnte eine Berücksichtigung von Ungleichheit zu mehr Gleichheit führen. Es geht darum, Herrschaft aus den Geschlechterbeziehungen rauszuwerfen, nicht die Ungleichheit zu leugnen.
Frauenpolitik und -publizistik beschränken sich, nachdem auf dem Feld der Bildung und der politischen Partizipation viel passiert ist, heute weitgehend darauf, in denjenigen Lebensbereichen Gleichheit umzusetzen beziehungsweise anzumahnen, die sich nach einer Ausbildung oder einem Universitätsstudium für Frauen öffnen – mit dem Ziel, die Bedingungen zu verbessern, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft, was Berufsaussichten und -ausübung angeht und vor allem Entlohnung, Gehalt, Honorar und schließlich Rente. Auf diesen Feldern hat sich unter dem Zeichen der Gleichheit ein publizistischer Grabenkampf entwickelt, in dem seit Jahrzehnten identische Argumente, Zustandsbeschreibungen und Zielvorstellungen dargelegt werden. Es sieht so aus, als könne frau als Politikerin und als Feministin machen, was sie wolle und müsse, sie käme keinen einzigen Schritt voran. Immer noch gibt es die gaps, die sich einfach nicht schließen wollen: einen Lohnabstand zwischen Männern und Frauen von (in Deutschland je nach der Art, wie man rechnet) 17 bis 27 Prozent, eine Bereitschaft, Zeit mit Kindern zu teilen, die bei Frauen das Hundertfache dessen ausmacht, was Männer aufbringen, einen eklatanten Mangel an weiblichen Führungskräften, dafür ein Verhältnis von neun zu eins, was die Verteilung von Frauen und Männern bei den Alleinerziehenden, den Teilzeitarbeitenden und Zuständigen für die Pflege alter Eltern betrifft, eine schreiende Unterrepräsentanz von Studentinnen in den sogenannten MINT-Fächern (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sowie erschreckende Zahlen, was die Karrieren von Männern und Frauen nach dem Erreichen des Doktorgrades an den Universitäten betrifft: Männer werden Professoren, Frauen Mütter. Diese gaps lassen sich mutatis mutandis in allen gesellschaftlichen Bereichen, Parteien, Verbänden, Interessengruppen, Milieus, Stadt und Land, Branchen und Institutionen auffinden, sie sind angeblich in den anderen europäischen Ländern kleiner und klaffen nur in Deutschland auf beschämende und entmutigende Weise mit der Tendenz, sich nicht nur nicht zu schließen, sondern womöglich weiter zu öffnen. Hier haben wir eine Stockung in der Wirklichkeit und in der Debatte, die laut danach ruft, den Blick von den üblichen Parametern wie Einkommen, Zeiteinteilung und Planungssicherheit mal abzuwenden und in das unübersichtliche Gelände der im sozialen Leben fein verteilten ererbten Herrschaftsmechanismen zu richten. Frau wird dann entdecken:
Es ist mehr als Gleichheit, was wir anstreben müssen, wenn der Prozess der Emanzipation weitergehen soll. Der historische Blick macht vieles verständlich, und er ist die erste Voraussetzung dafür, die aktuelle Situation zu verstehen. Sie kann dann viel leichter verändert werden. Man sollte die Bewegungen und Stimmen von Männern und Frauen als ästhetische Phänomene wahrnehmen und bewerten, während man zugleich die Anteile von Herrschaft, die noch darin stecken mögen, kritisch anschaut und praktisch entfernt. Man sollte die Ansprüche und Selbstbilder der Geschlechter immer wieder daraufhin befragen, was sie an Altlasten noch mit sich herumschleppen und ob und wo sich die individuellen von den geschlechtsspezifischen Merkmalen oder Zielvorstellungen trennen lassen. Man sollte eine Ungleichheitspolitik wie die Quotierung, also die Bevorzugung von Frauen bei der Stellenbesetzung, auf allen Hierarchieebenen in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen (bis zu einem erstrebten Anteil) forcieren. In Schulen wird beklagt, dass die Jungen zurückfallen, weil Mädchen im Zuge des kritisch-feministischen Dauerfeuers mehr Aufmerksamkeit bekämen. Aber liegt es wirklich daran? Könnte es nicht auch sein, dass Mädchen mehr Disziplin an den Tag legen, weil ihnen die Bereitschaft zu gehorchen nach der langen Unterdrückungsgeschichte des weiblichen Geschlechts noch in den Knochen steckt? Das kritische Besteck des Feminismus muss feiner werden, es kann nicht sein Bewenden damit haben, überall fünfzig Prozent zu fordern. In der konkreten Situation sind diese groben Verteilungsschlüssel oft wenig wert.
Die Freiheitsimpulse in allen modernen Gesellschaften stärken das Individuum gegen Konformitätszwänge, die von Traditionen und Institutionen ausgehen, sie verlangen zunehmend Respekt vor dem Besonderen. Eine neue Herausforderung, vor der die Frauenbewegung steht, liegt darin, dem Geschlecht auf der großen Skala des individuellen Charakters sozusagen seinen Platz zuzuweisen. Es hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass gar nicht alle Frauen Mütter werden wollen. Und die Emanzipation war einen großen Schritt weiter, als die kinderlose Frau nicht mehr abgewertet, sondern ihre Entscheidung als eine individuelle akzeptiert wurde. Aber das war ein langer Kampf! Mädchen, die auf Bäume klettern, sind heutzutage Kinder, die ihre Lebensfreude zeigen, und keine aus der Art geschlagenen Evastöchter mehr. Streben sie aber später Führungspositionen an, werden sie immer noch gerne gedeckelt. Väter, die in Elternzeit gehen, ernten im Feuilleton Applaus, aber in den Betrieben macht man sie runter. Es sind also weniger die Männer, die es versäumen, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, als die Strukturen, in denen sie arbeiten, die ihnen das erschweren. Die Kategorie der Herrschaft kann sich vom Geschlecht lösen und unpersönlich werden, sie taugt dann auch dazu, Beschränkungen im Leben von Männern dingfest zu machen. Auf den Spuren solcher Betrachtungen, Bewertungen und kritischen Zugriffe richtet der Diskurs der Emanzipation heute viel mehr aus als nur das Plädoyer für Gleichheit. Im vorigen Jahrhundert war es wichtig, die Kategorie der Gleichheit in den Vordergrund zu stellen, weil das Geschlechterverhältnis vor allem durch die Brille der Verschiedenheit angeschaut wurde – auch in der Tradition der Frauenrechtlerinnen des Jahrhunderts zuvor. Inzwischen denken wir differenzierter. Und wir haben die Gleichheit so gut im Blick, dass wir nichts verlieren, wenn wir die Verschiedenheit zum Thema machen. Zumal es für beide Geschlechter inzwischen darum geht, Herrschaftsstrukturen zu erkennen und aufzulösen.
Kapitel 2: Räume
Dass Frauen ihre Beine lieber und öfter überschlagen als Männer, vor allem in öffentlichen Räumen, mag etwas zu tun haben mit den Unterschieden in der Konstruktion männlicher und weiblicher Gelenke, die erheblich sind. Mit Sicherheit entscheidender aber ist die Geschichte der Menschheit, verstanden als Summe der Entfaltungsmöglichkeiten beider Geschlechter. Ähnlich verhält es sich mit männlichen und weiblichen Stimmen. Ein Bass füllt einen großen Saal, die Luft schwingt bereitwillig unter seinem Atem und produziert mächtige Schallwellen. Ein Sopran spielt auf ganz anderen Frequenzen, und seine Kraft, einen Raum zu füllen, scheint geringer. Aber ob das nur an der Anatomie der jeweiligen Kehlen liegt, muss bezweifelt werden. Denn dem stimmlichen Ausdruck teilt sich stets die Psyche mit. Dass in Talkshows heute noch das weibliche Timbre öfter zittert als das männliche und deshalb von den Moderatoren bereitwilliger in seinem Vortrag unterbrochen wird, hängt damit zusammen, dass alle Frauen einen Rucksack tragen, auf dem das Paulus-Wort geschrieben steht: »Die Frau schweige in der Gemeinde.« Sie hatten allzu lange nicht die geringste Chance, ihre Stimmen in weiten Räumen widerhallen zu lassen. Allgemein gilt: Die Größe des Raumes, den das eine oder das andere Geschlecht einnehmen durfte und darf, ist der bedeutendste und auch am leichtesten messbare Unterschied zwischen ihnen. Er ist riesenhaft.
Wir wissen nicht, wann es begonnen hat, dass die Männer die Frauen im Hause hielten – ähnlich dem Nutzvieh, das sich auch nicht entschließen konnte, wieder in die Wildnis hinauszulaufen, nachdem es einmal gezähmt und im Stall eingesperrt war. Vielleicht konnte es sich entschließen, aber es konnte seinen Entschluss nicht in die Tat umsetzen. Der Vergleich zwischen Nutzvieh und Frauen hinkt insofern, als die Frauen den Prozess ihrer Einhegung an der Seite und nach dem Gebot der Männer über lange Zeiträume hinweg scheinbar einvernehmlich mitgetragen haben. Jedenfalls sind größere Aufstände nicht geschichtsnotorisch geworden. Auch wurden Frauen nicht gezähmt wie Pferde, sondern entwickelten ihre zahme Seite stetig und nolens volens sich anpassend an die rohen Umstände der menschlichen Anfänge. Wir hätten so gern eine Ursprungsgeschichte, in der es erstmalig passiert wäre, was dann für lange Zeiten gelten sollte: dass die Männer ihre Herrschaft über die Frauen etabliert und sie eingesperrt haben, aber die gibt es nicht. Was in der Bibel über den Gehorsam steht, den die Frau dem Manne schulde, baut ja schon auf einer Vorgeschichte auf, die in graue Urzeit zurückweist, das Herrschaftsverhältnis nur noch mal in Schriftform beglaubigt und es auch noch heiligspricht. Es wird so gewesen sein, dass ihre überlegene Körperkraft und sthenische Angriffslust es den Männern nahelegte, sich die Frauen zu unterwerfen – mit eben den Mitteln der Gewalt, die sie in der beständigen Auseinandersetzung mit männlichen Rivalen (um Land und andere Ressourcen, zu denen auch die Frauen gehörten) ausgebildet hatten. Wie das im Einzelnen vor sich ging, ist (für unsere Fragestellung) gleichgültig. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir keinen Mythos besitzen, in dem die Hierarchie zwischen den Geschlechtern erfunden und festgeschrieben wurde und den wir heute umschreiben könnten, sondern dass die Vorgeschichte aller Wahrscheinlichkeit nach kalt, grausam und blutig und weitgehend wortlos verlief. Und dass es keine Rücksicht gab auf zarte Kinder und stillende Frauen, außer dem Schutz durch einen Mann, der imstande war, Gegner aus dem Feld zu schlagen und mit genügend Jagdbeute in die Höhle zurückzukehren.
Wenn wir die Dinge so sehen, erkennen wir, dass die Emanzipation erst beginnen konnte, nachdem die Legitimität der Gewalt durch das geschriebene Recht und die Idee der Gleichheit so weit eingeschränkt war, dass kleinere, schwächere und mit Piepsstimmen geschlagene Menschen ihre Würde und ihre Unversehrtheit in der Welt der Gedanken, aber auch praktisch vor Gericht und schließlich in der öffentlichen Meinung verteidigen konnten. Mit anderen Worten: Es waren die Verkündigung der Menschenrechte und die Konzentration der Gewalt beim Staat nach der Aufklärung, die der Frauenemanzipation zuarbeiteten. Ohne sie wäre an Gleichstellung niemals zu denken gewesen. Wenn wir die Perspektive umkehren und die Menschenrechte mit einer Herausforderung an alle politischen Systeme in der Zeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts verbinden, die von willkürlicher Gewalt geprägt waren, erkennen wir ferner, dass Frauenemanzipation eine Abkehr von jeder Art Gewaltherrschaft zur Voraussetzung hat. So einfach ist das. Die Emanzipation verlangt als Bedingung ihrer Möglichkeit eine zivilisatorische Stufe, welche die Gewalt als politische teilt, als körperliche ächtet und einhegt, beim Staat konzentriert und gegebenenfalls sanktioniert. In Diktaturen mit gewaltbereitem Untergrund sind Frauenrechte keinen Pfifferling wert. Sie sind die schöne Blüte einer Gesellschaft, in der das Recht die Gewalt bezwungen und sich die Gleichheit von einem bloßen Motto zu realer Chancenvielfalt entwickelt hat. Insofern sind die Verteidigung der Demokratie und der Kampf gegen jegliche Diskriminierung das Erste und Beste, was zur Sicherung der Emanzipation, ihrer Gewinne und Errungenschaften, getan werden muss.
So ist denn auch die Selbstbefreiung der Frauen in den letzten hundertfünfzig Jahren, in denen die modernen westlichen Gesellschaften entstanden sind, mit Siebenmeilenstiefeln vorangeschritten. Das Jahrhundert davor darf man schon mitrechnen, allerdings lief die Emanzipation ab dem Ende des 18. Jahrhunderts noch im Schneckentempo. Es gab Unterbrechungen, es gab Neuansätze, es gab vor fünfzig Jahren einen Aufbruch mit enormem Crescendo. Aber derzeit stecken wir in einer Generalpause. Frau weiß nicht recht, was tun, um weiter voranzukommen. Auch fühlt sie sich unter Druck durch die politische Rechtsentwicklung überall in der westlichen Welt, es schwelt die böse Ahnung, dass Fremdenhass, Rassismus, Misogynie, Nationalismus, eine weitere Aufwertung von Dominanzgesten auf militärischem Gebiet und Ellenbogenmentalität im wirtschaftlichen Bereich auch Frauenrechte nicht unangetastet lassen werden. Noch ist die Bedrohung eher atmosphärischer Natur. In dieser Situation könnte es nützlich sein, sich bewusst zu machen, was Emanzipation jenseits von verbrieften Rechten bedeutet und was es eigentlich gewesen ist, das Frauen über so viele Jahrhunderte vorenthalten wurde. Und da ist ein wichtiges Stichwort: Räume.
Frauen sollten in Innenräumen verbleiben, dort, wo man sie nicht sah und wo sie ihrerseits nichts Neues sehen und erleben konnten. Die raumgreifenden Schritte waren den Männern vorbehalten. Frauen trippelten. In China verwehrte man ihren Füßen durch Einbinden das natürliche Wachstum, sodass sie nur zu Trippelschritten fähig waren. Lassen wir die Schuhmode unserer Zeit beiseite. Die Modi der Verhinderung, mit denen man Frauen in Binnenbereichen hielt und sie vom Erkennen, Beschreiten und Erobern der Außenräume, gedanklicher und gegenständlich-irdischer, abhielt, waren vielfältig. Hier interessieren erst mal Räume im Sinn von Territorien. Schauen wir den Männern zu, wie sie sich die Erde untertan gemacht haben.
Der Welthandel und die Kriegskunst waren die großen Bewährungsfelder, auf denen junge und reife Männer seit der Antike ihre Kräfte und Fähigkeiten entwickelten, einsetzten und aneinander maßen. Es ging immer darum, Räume zu erschließen, zu erobern und zu sichern. Dafür wurden fantastische Leistungen erbracht. Die Schifffahrt in der Antike, der Vorstoß nach Afrika und Asien, schon der Bau der großen Segler und Ruderboote, das waren gewaltige Abenteuer und berauschende Erfahrungen. Von den Seeschlachten mit ihren unermesslichen Opfern an Menschen und Material berichten die Historiker schaudernd. Die Kriege des Mittelalters und der Neuzeit, die Kreuzzüge, die Religionskriege, die Kabinettskriege, die Weltkriege, sie wollten weiterhin Räume besetzen, aneignen, aufteilen, bebauen, sie entfesselten eine sich steigernde Gewalt, sie erschütterten die Menschheit und stifteten sie an zu epochalen Werken in der Theorie, der Philosophie und Dichtkunst, Werke, in denen man darum rang, die eigene menschliche Natur und ihr schöpferisches Vermögen ebenso wie ihren Zerstörungsdrang zu verstehen und Werte zu entwickeln, an denen gemessen das menschliche Zusammenleben stabiler werden könne. Derweil bearbeitete auch das zivile Leben mit Landwirtschaft, Handwerk und Städtebau die irdischen Räume. Es gab ferner die Epoche der großen Entdeckungen: Auf dem Seeweg nach Indien stieß man auf Amerika, und so ging es weiter, bis die Umrisse der Pole und der letzten unbekannten Inseln die Landkarte der Erde vervollkommneten. Sie ist ein grandioses Epos, die Eroberung, Besetzung, Aufteilung und Nutzung des irdischen Raumes.
Und sie ist eine Erzählung ganz ohne weibliche Autoren. Abgesehen von der Kleinlandwirtschaft, in der Frauen tätig waren, soweit der Zustand ihrer Füße es ihnen erlaubte, waren sie an der Aneignung des Raumes, so wie er die Menschheitsgeschichte bis ins vorletzte Jahrhundert hinein geprägt hat, nicht beteiligt. Was bedeutet das für ihre Psychen, für ihr Selbstbewusstsein, für ihr Tun und Lassen? Und was hat ihre Rolle als Entdecker und Krieger aus den Männern gemacht? Die Tatsache, dass die großen Feldzüge, Erkundungszüge, Eroberungszüge, Welthandelskompanien und Städtebauarbeiten eine rein männliche Angelegenheit waren, muss etwas heißen für die Entwicklung der Geschlechter. Man befindet heute, dass weibliche Gehirne in Bezug auf räumliches Vorstellungsvermögen deutlich weniger leistungsfähig seien als männliche. Zur Erklärung verweist man auf den unterschiedlichen Zustand neuronaler Vernetzungen. Ein Blick in die Geschichte lehrt, woher dieser Unterschied stammt.
Junge Männer mussten, um Schiffbauer oder Soldat zu werden, eine Ausbildung auf einer Werft oder als Rekrut bei der Truppe machen – beides war Frauen verwehrt. Es gab für sie bis ins 19. Jahrhundert hinein nicht einmal Schulen und auch dann erst mal nur Schrumpfformen jener Institute, an denen die männliche Jugend lernte und studierte. Das war überall auf der Welt so. Das vor-aufgeklärte Weltbild mit den ihm entsprechenden Geschlechterrollen kannte keine Frauen, die eine Ausbildung gemacht oder studiert hätten, um Expertenwissen zu erwerben und einen Beruf auszuüben (von raren Ausnahmen abgesehen). Der Sinn eines Frauenlebens bestand in seinem Dienst an der männlichen Menschheit. Weibliche Menschen sollten Kinder auf die Welt bringen und großziehen, um so das Geschlecht des Mannes fortzupflanzen, und sie sollten hausnahe Tätigkeiten ausführen, etwa gärtnern, spinnen, brauen, backen, kochen und das Kleinvieh versorgen. Kenntnisse, die dafür nützlich waren, durften sie sich aneignen. In den Oberschichten gehörten Musik, Tanz und Lyrik dazu, während Spinnen und Backen weniger galten, dies wurde von Mägden erledigt. Jede weitere Bildung aber war überflüssig und wurde gar für schädlich befunden. Irgendwann aber tat sich der Raum des Wissens auch für Frauen auf. Nicht einfach so, sondern weil Frauen ihn unter Missachtung ihrer beschränkten Zukunftsaussichten ertrotzten.
Zum Beispiel in Zürich in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Universität dort war eine junge Gründung, und die weitblickenden Herren, die ihr Lehrprogramm ausarbeiteten, spürten, dass etwas in der Luft lag: der Wunsch junger Frauen aus besseren Kreisen, mehr über die Welt zu wissen als Geburtshilfe und Kochrezepte. Das Kalkül ging auf. Aus vielen europäischen Ländern kamen höhere Töchter in die Schweiz, um dort ihren Wissensdurst zu stillen. Sie beziehungsweise ihre Familien zahlten bereitwillig die saftigen Gebühren. Niemand traute den Mädchen viel zu, weder ihre Eltern noch die Professoren, erst recht nicht die Kommilitonen. Studentinnen wurden regelrecht gemobbt. Aber sie setzten sich durch und die akademische Welt in Erstaunen. Franziska Tiburtius, Anita Augspurg, Ricarda Huch und Rosa Luxemburg gehörten damals zu ihnen. Jetzt war Wut gerechtfertigt, wenn es weitere Hemmnisse gab, die Frauen den Eintritt in die Räume des Wissens verwehrten. Die akademische Welt, in der die Männer so lange unter sich gewesen waren, hielt mächtig gegen die Aspirationen der Frauen. Man betrachtete ihre Studien als eine Art Accessoire, als Zusatzqualifikation für den Small Talk im Salon, den eine kluge Ehefrau an der Seite eines Mannes von Stand führen könnte. Einen akademischen Abschluss brauchten sie dafür nicht, also wurde er verweigert. Dann, als das nicht mehr ging – die Gleichheit als politische Kategorie drängte mit Macht in die Praxis –, verbot man ihnen eine Karriere als Ärztin, Professorin, Anwältin oder Pfarrerin. Sie durften sich, weil sie Frauen waren, nicht niederlassen oder eine Approbation erwerben. Bis sie es dann endlich doch konnten, mussten viele weitere Kämpfe durchgefochten werden.
Warum leisteten Männer in der großen Mehrheit einen solch rigorosen Widerstand, als erstmals Frauen in die akademischen Räume vorstießen? Es hat zu tun mit Weltbildern, die gelten sollten. Die Aufteilung der Geschlechter auf die Räume des Lebens, auf Territorien wie auch auf die Räume des Wissens mit ihren historischen Schätzen und möglichen Neuerungen war tradiert worden und hatte in den Vorstellungen der Menschen eine die Lebenswege vorzeichnende Tiefenwirkung. Für eine Frau war es wichtig, dass sie einen Mann fand, der ihr seinen Namen gab, dessen Kinder sie zur Welt bringen würde und der ihr dafür seinen Schutz und eine begrenzte Teilhabe an seinem Vermögen angedeihen ließ. Alles andere zählte nicht. Für einen Mann war es wichtig, dass er seine Fähigkeiten entwickelte und ein würdiger Nachfolger seines Vaters als Bauer, Hufschmied, Gelehrter oder Aristokrat wurde. Ob und wann er eine Frau fände, mit der er sein häusliches und Gattungsleben führen könnte, war vergleichsweise weniger wichtig. In diesem Weltbild mit dem entsprechenden Verhältnis der Geschlechter gehörte die Erde den Männern, die sie sich, wie Gott es gewollt hatte, untertan und urbar machten. Frauen waren von dieser Weltaneignung ausgeschlossen, sie lebten in Innenräumen und betraten die Außenwelt nur insoweit, als ihr männlicher Vormund es gestattete.
Eine Frau, die studieren ging, rüttelte an diesem Weltbild. Eine Jurastudentin, die Richterin werden wollte, machte die Aufteilung von Räumen, die schätzungsweise auf neunzig zu zehn hinauslief – wobei der Löwenanteil von neunzig den Männern und die Restgröße von zehn den Frauen zukam –, zunichte. Das durfte nicht sein. Die Macht der Tradition liegt in ihrem Ewigkeitsanspruch. Sie will immer weiter gelten. Die Männer, die in Zürich und anderswo während der 1860er bis 1890er Jahre verbissen gegen Studentinnen der Rechte, der Theologie, der Medizin oder der schönen Künste kämpften und ihr Weltbild mit der Neunzig-zu-zehn-Aufteilung der Räume verteidigten, sahen sich nicht als Frauenfeinde oder -verächter, und sie waren es subjektiv auch nicht. Sie wollten den Frauen ihre Komfortzone erhalten: Die sollten mal schön bei Mann und Kindern zu Hause bleiben, anstatt sich den rauen Wettern der Wissenschaften, der Juristerei, der Heilkunst oder den Streitereien der verschiedenen philosophischen Schulen auszusetzen. Natürlich waren so gut wie alle Männer davon überzeugt, dass Frauen für die Wissenschaften ungeeignet seien. Sie erfanden die bizarrsten Indizien, angefangen bei der weiblichen Kopfform bis hin zur angeborenen Scham (eine Frau in der Anatomie – nicht auszudenken!), mit denen sie belegen zu können glaubten, dass eine Frau nicht in die Universität gehöre. Es gab strenge Verbote. Aber Zürich wies dann doch den Weg. Und Frauen beschritten ihn, nachdem die Schranken gefallen waren, in großer Zahl. Heute lacht man über die Vorwände, unter denen man einst weibliche Studienanfänger draußen vor der Tür der Alma Mater gehalten hat. Damals war es nicht zum Lachen, weder für die Frauen, die als erste raumgreifende Schritte ins Reich des Wissens machten, noch für die Männer, die sie aufhalten wollten. Für beide ging es um ein Weltbild. Die einen wollten es erhalten, die anderen es umstoßen.

