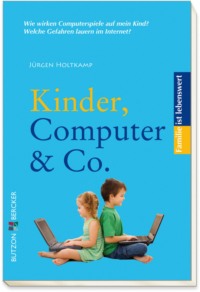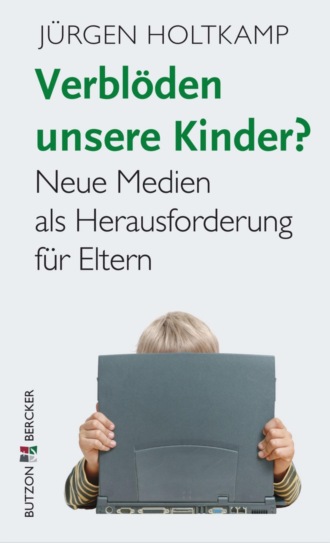
Полная версия
Verblöden unsere Kinder?
DDR-Nostalgische: Sie sind resigniert, gehören zu den Verlieren der deutsch-deutschen Vereinigung, halten an preußischen Tugenden fest und an altsozialistischen Vorstellungen, die alte DDR-Zeit wird von ihnen verklärt. Zu Zeiten des SED-Staates waren sie in den Führungskadern. Heute sind sie entweder arbeitslos oder üben einfache Berufe aus. Sie sind sparsam und kritisieren den westlichen Kapitalismus.
Etablierte: Sie haben hohe Ansprüche an das Leben, sehen sich als gesellschaftliche Elite, sind überaus selbstbewusst, gebildet und grenzen sich von anderen Milieus bewusst ab. Sie machen Karriere, übernehmen Führungsverantwortung.
Sie mögen Kunst und Kultur, exklusive Reisen und sind überaus aufgeschlossen gegenüber technischen Innovationen. Das Einkommen ist entsprechend ihrer Ausbildung teilweise sehr hoch.
Bürgerliche Mitte: Mit 15 Prozent stellt die bürgerliche Mitte das größte Milieu dar. Der Name ist Programm: Personen dieses Milieus leben den „Mainstream“, möchten sich beruflich und sozial etablieren und verfügen über einen ausgeprägten Hang zu harmonischen Verhältnissen. Neu hinzugekommen ist in diesem Milieu die Abstiegsangst, den erreichten finanziellen und sozialen Status nicht halten zu können. Sie möchten ein angenehmes und komfortables Leben führen. Sport, Vereine und Beschäftigung mit den Kindern sind ihre Merkmale. Sie haben mittlere Bildungsabschlüsse und ein durchschnittliches Einkommen.
Konsummaterialisten: Es handelt sich dabei um die konsumorientierte Unterschicht. Die finanziellen Mittel sind sehr beschränkt, viele Angehörige dieses Milieus leben fast ausschließlich gegenwartsorientiert. Sie fühlen sich als benachteiligte Gruppe und ihre Wünsche stehen in einem eklatanten Gegensatz zu ihren finanziellen Möglichkeiten. Fehlende Schul- und Ausbildungsabschlüsse sowie ein hoher Anteil von Arbeitslosen kennzeichnen die soziale Lage dieses Milieus. Fernsehen, Unterhaltung und Spaß gehören zu den wichtigsten Freizeitinteressen.
Postmaterielle: Sie sind sehr gut gebildet, ihre Grundhaltung ist tolerant und liberal.
Dieses Milieu denkt in globalen Zusammenhängen, setzt sich kritisch mit der Globalisierung auseinander, engagiert sich für erneuerbare Energien und ist politisch. Sie sind erfolgreich im Beruf, legen Wert auf individuelle Freiräume. Weiterbildung sehen sie als lebensbegleitende Herausforderung. An Kunst und Kultur sind sie sehr interessiert. Auf Grund ihrer hohen Bildungsabschlüsse verfügen sie über ein hohes Einkommen, kaufen selektiv und umweltbewusst.
Moderne Performer: Sie sind eine junge Elite, die ein intensives Leben mit vielen Optionen führt, mit dem Ziel, ihre eigenen Leistungsgrenzen zu erfahren. Multimedia ist ihre Lebensphilosophie. Sie sind selbstständig und wollen materiellen Erfolg. Kommunikationstechnologien sind integraler Teil ihres Lebens. Ihr Konsumverhalten ist multikulturell, sie legen Wert auf das „Besondere“. Der Altersdurchschnitt liegt unter 30 Jahre, verbunden mit einem sehr hohen Bildungsniveau.
Experimentalisten: Der Name ist Programm; sie experimentieren mit Lebensstilen, Szenen und Kulturen, der Altersdurchschnitt ist unter 30 Jahre. Zwänge lehnen sie ab und werden daher auch als „Lifestyle-Avantgarde“ bezeichnet. Ihnen sind beruflicher Erfolg und sozialer Status weniger wichtig. Sie nutzen Multimedia intensiv, spielen Video- und Computerspiele, engagieren sich aber auch sozial. Kommunikation und Unterhaltung sind ihre Triebfedern, sie sind ständig unterwegs, um etwas Interessantes zu entdecken. Sie haben gehobene Bildungsabschlüsse, ein durchschnittliches Einkommen und geben das Geld für Ungewöhnliches (z. B. Extremsportarten) aus.
Hedonisten: Sie sind die junge spaßorientierte Unterschicht. Fun und Action sind die treibenden Kräfte dieses Milieus. Auffallend ist, dass ihre Alltagsrealität in krassem Widerspruch zu ihrem Lebensstil steht, sie sind nicht selten aggressiv. Für Fernsehen, Computerspiele, Fußball sowie Kneipenbesuche interessieren sie sich besonders. Weil sie gerne und viel konsumieren, steht bei ihnen die Multimedia-Ausstattung ganz weit oben auf der Einkaufsliste. Sie verfügen über einfache bis mittlere Bildungsabschlüsse, nicht selten sind sie ohne abgeschlossene Berufsausbildung.
Die Sinus-Milieus sind ein Erklärungsansatz für gesellschaftliche Entwicklungen und stellen eine Momentaufnahme der Gesellschaft dar, ohne den Anspruch zu erheben, wie die Gesellschaft sein sollte. Damit können gesellschaftliche Veränderungen besser eingeordnet und gedeutet werden. Sie zeigen, in welchen finanziellen Verhältnissen die Menschen leben, an welchen Werten sich die Menschen orientieren und welche Medien sie nutzen.
Anna und Thomas wachsen in verschiedenen Milieus auf. Anna dürfte in einem postmateriellen Milieu oder der bürgerlichen Mitte groß werden, während Thomas in einem konsumorientierten Milieu lebt. Anna nutzt Medien aktiv für die eigene Bildung, wie sie es von ihren Eltern vorgelebt bekommt, derweil hinkt Thomas fast hoffnungslos hinterher, nutzt Computer und Fernsehen fast nur zum Spielen.
Aufwachsen in der Mediengesellschaft
Globalisierung, Mobilität, Arbeitslosigkeit, gesellschaftlicher Wandel oder Enttraditionalisierung und Individualisierung sind Ausprägungen hoch entwickelter Gesellschaften, die massiv in die Familien hineinwirken und diese unter einen enormen Anpassungsdruck setzen. Familienleben ist heute völlig anders, offener gegenüber der Umwelt, die Familienbande werden lockerer und die Familie verliert ihre Exklusivität. Die Medien- und Erlebnisgesellschaft hat die Familien erreicht. Auch in ländlichen Regionen sind durch Satellitenschüsseln Fernsehserien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ebenso bekannt wie in städtischen Gebieten. Die ehemalige Unterscheidung zwischen Stadt und Land lässt sich so nicht mehr aufrechterhalten.
Ist es da verwunderlich, wenn der Einfluss der Medien auf die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen zunimmt? Gleichsam stellt sich nicht nur bei den Eltern ein beklemmendes Gefühl ein, wenn Medien (zu) intensiv genutzt werden.
Führen die vielen Gewaltdarstellungen, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, nicht zu einer Desensibilisierung? Gibt es nicht doch einen Zusammenhang zwischen den Gewaltsendungen in Film, Fernsehen und Internet und den täglichen Gewaltdelikten auf Deutschlands Schulhöfen? Täuscht etwa der Eindruck, dass Computerspielen und Internet ein hohes Suchtpotential innewohnt? Die Liste der offenen Fragen angesichts einer Medienwirklichkeit, die alle Kinder und Jugendlichen erreicht, und zwar überall in Deutschland, ist noch längst nicht beendet und zeigt, wie nah Segen und Fluch der Medien in der Kindererziehung beieinanderliegen können.
Es gibt Eltern, die deshalb versuchen, ihre Kinder in einer „medienfreien Zone“ aufwachsen zu lassen, weil sie den Einfluss der Medien auf ihre Kinder als schädlich ansehen. Das Problem dabei ist, dass dies in der Mediengesellschaft schlichtweg unmöglich ist. Selbst wenn Eltern Radio, Fernsehen, Computer und Handy aus dem privaten Umfeld verbannen, so sind diese in anderen Bezügen, bei Freunden, Nachbarn und in der Schule, vorhanden, werden gehört, gesehen und benutzt.
Für Professor Bernd Schorb müssen Medien als ein „Faktor im Sozialisationsprozess“ angesehen werden. Damit meint er, dass durch die „Interaktion“ mit Medien Werte, Normen und das Verhalten von Kindern verändert werden können. Kinder erfahren etwas über die Welt, ohne je an diesem Ort gewesen zu sein. Dokumentationen über das Leben in der Sahara, das Abschmelzen des ewigen Eises oder die Artenvielfalt des Amazonas führen dazu, dass Menschen etwas über ferne Welten und Orte erfahren. Das „Gesehene und Gehörte“ muss verarbeitet, in einen Zusammenhang zum eigenen Leben gebracht und „kontextualisiert“ werden. Allerdings sollte dabei nicht vergessen werden, dass die „Prägekraft“ für die Erfahrung längst nicht so hoch ist wie eine Lebenswelt, die mit allen Sinnen erfahren werden kann. Wir können weder die Kälte des Eises noch die Hitze der Sahara fühlen und die verschiedenen Pflanzen nicht anfassen oder riechen. Mediale Erfahrungen können nie „primäre“ Erfahrungen werden, was Eltern und Pädagogen dazu verleitet, mediale Erfahrungen als „minderwertig“ zu bezeichnen. Natürlich haben diese medialen Erfahrungen auch ihre Vorteile, denn nicht jeder möchte die Hitze der Sahara oder die Kälte des ewigen Eises spüren. Und die meisten schauen sich Krokodile, Schlangen und Spinnen lieber im Fernsehen als in der Natur an.
Mediale Erfahrungen sind immer selektiv, weil sie von Menschen erzeugt werden. So sind Fernsehbilder Momentaufnahmen. Redakteure schneiden Bilder, Musik und Töne nach eigenen Kriterien, betonen bestimmte Inhalte, erzeugen Stimmungen und ziehen eigene Schlussfolgerungen, um bei den Fernsehzuschauern beispielsweise Betroffenheit auszulösen oder zu Aktionen aufzurufen. Objektive Fernsehberichterstattung gibt es im eigentlichen Sinne nicht, auch wenn Journalisten immer danach streben sollten, so objektiv wie möglich zu berichten und eigene Bewertungen eindeutig zu kennzeichnen.
Die Amokläufe von Robert S. am 26. April 2002 in Erfurt, von Sebastian B. am 20. November 2006 in Emsdetten und von Tim K. im März 2009 führten zu einer Diskussion über die Wirkung der neuen Medien auf Kinder und Jugendliche. Immer war der „Schuldige“ schnell gefunden: Es waren die Computerspiele, die Jugendliche zum Töten animierten.
Die Argumentation ist einfach und daher populär und weit verbreitet, zudem klingt sie in den meisten Ohren schlüssig. Dass eine solche Argumentation es sich zu leicht macht und der wissenschaftlichen Diskussion nicht entspricht, ist dann nicht mehr wichtig, denn das Problem ist doch – zumindest auf den ersten Blick – gelöst: Schuldig an zunehmender Gewaltbereitschaft von Jugendlichen seien Computerspiele, die Actionfilme, das Internet – die Medien. Auch Pädagogen verschließen sich nicht dieser Argumentation. Ist es nicht so, dass bei dieser Art von Computerspielen doch was hängen bleiben muss? Wer solche Spiele konsumiert, bei dem muss doch etwas nicht in Ordnung sein ...
Das stimmt übrigens, bei den Tätern war in der Tat etwas nicht in Ordnung. Der ausschließliche Verweis auf die Computerspiele ist aber falsch und geht weit hinter den Stand der Verhaltensforschung zurück.
„Welches sind die Motive der Täter?“ und „Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen?“ sind Fragen, die geklärt werden müssen. Notwendig ist die genaue Betrachtung des einzelnen Falles. Gespräche mit Eltern, Verwandten, Lehrern und Mitschülern sowie Internetbekanntschaften ergeben annähernd ein Profil vom Charakter der Person, ihren Sorgen, Nöten, Problemen und Ängsten. Das aber ist in der schnelllebigen Mediengesellschaft und dem „Bildzeitungsjournalismus“ uninteressant. Da ist die Bildüberschrift „Am Computer übten sie das Töten“ (http://www.bildblog.de/tag/Computerspiele) doch mediengerechter.
„Was macht Sozialisation aus?“ und „Wie vollzieht sich Sozialisation?“ sind Fragen, die für das Verständnis des Aufwachsens von Kindern in einer durch Medien geprägten Welt maßgeblich sind. Sind unsere Kinder der Medien-Sozialisation nun hilflos ausgeliefert? Und wenn nicht, wie und welche „Selbstheilungskräfte“ verbergen sich in den Kindern?
Dass es einen sozialen Wandel in den vergangenen 40 Jahren gab, der einschneidend alle Lebensbereiche erfasst und verändert hat, ist offensichtlich. Ulrich Beck hat diesen Wandel in seinem Buch „Risikogesellschaft“ mit Individualisierung und Enttraditionalisierung beschrieben. Er meint damit, dass die traditionellen Formen von Orientierung und Bindung nachlassen, Normen und Werte sich verändern und auf die Sozialisationsinstanzen Familie, Schule, Nachbarschaft auswirken. Auf der einen Seite, so Beck, eröffnen sich für das Individuum neue Möglichkeiten und Perspektiven, es kann selbst (individuell) entscheiden, was und wann es etwas macht, wo es sich engagiert, wie es sein Leben führen möchte. Andererseits hat diese „neue Freiheit“ auch ihren Preis, weil es den geschützten Raum der Familie verlässt, Sicherheiten verliert, sich entscheiden und wählen muss, wie es das Leben gestaltet.
Der Begriff der „Selbstsozialisation“ bringt es auf den Punkt, allerdings zeigt sich auch, dass nicht alle Heranwachsenden in gleicher Weise über diese Form der Selbstsozialisation verfügen, nicht alle sich selbst steuern können und z. T. die neu gewonnene Freiheit ihnen mehr Probleme bereitet als Vorteile bietet. Sie sind überfordert und es gelingt ihnen nicht, mit der gewonnenen Freiheit verantwortungsvoll umzugehen. Für Kinder der Mediengesellschaft hat dies gravierende Folgen: Die Kindheit ist kein geschützter Raum, wie manche glauben, und die Anpassungsfähigkeit von Kindern wird nicht selten überstrapaziert.
Die Wohnsituation vieler Heranwachsender ist beengt, es gibt zu wenig geeignete Spielplätze, sie haben zu wenig Bewegung und ihre Ernährung ist nicht ausgewogen. Aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern und die fehlende Betreuung sind sie nicht selten bis abends sich selbst überlassen, eine mögliche Betreuung durch die Großeltern ist durch weite räumliche Entfernungen nicht möglich. Das alles sind Faktoren, die sich negativ auf die Sozialisation der Kinder auswirken können.
Gleichzeitig verfügen Kinder und Jugendliche über hohe materielle Ressourcen, sind längst im Blickpunkt der Werbung als wichtige Zielgruppe erkannt, werden mit Kaufanreizen auf allen Sendern, im Radio und Internet überschüttet. Die Shell-Studie beschreibt die heutige Jugend als „Generation unter Druck“ (vgl. Shell-Studie, 2006). Die eigene Identität muss individuell ausgestaltet, der Alltag nicht gelebt, sondern „inszeniert“ werden, selbst der Geburtstag wird hier zum „Event“. Die Normalbiografie wird zur Bastelbiografie als quasi lebenslanger Prozess.
Eine Lebensplanung mit Ausbildung/Studium, sicherem Arbeitsplatz und der Familiengründung wird unter diesen Vorzeichen immer unwahrscheinlicher, die Realität sind mehrere Berufswechsel und Umzüge, die Karriere verläuft in Wellen, Arbeitslosigkeit trifft auch Hochqualifizierte und die Familienphase beginnt – wenn überhaupt – nach dem dreißigsten Lebensjahr.
Der „flexible Mensch“ stellt das neue Leitbild dar, so der amerikanische Soziologe Richard Sennet. Im flexiblen Kapitalismus sind nur anpassungsfähige und reaktionsschnelle Menschen erfolgreich. Diese Form des neo-liberalen Kapitalismus bringt massive Nachteile für alle, die sich nicht so schnell wandeln können, und verstärkt die bereits bestehenden Ungleichheiten in der Gesellschaft.
Schon heute sind die Folgen für die Gesellschaft nicht nur für alle Menschen sichtbar, sondern führen bei den Heranwachsenden zu Verunsicherungen. Sie stehen unter Druck, den ständig wechselnden Bildungsanforderungen gerecht werden zu müssen, die von Staat und Wirtschaft gesetzt werden und sich bereits in den Sozialisationsinstanzen Kindergarten und Schule massiv auswirken. Die Einführung einer Fremdsprache in der Grundschule, die Verkürzung der Gymnasialzeit auf 8 Jahre und die Umstellung der Studiengänge auf Bachelor/Master-Abschlüsse sind mehr als nur Indizien für die Veränderungen. Dass dabei den Medien, vor allem dem Internet, eine besondere Rolle zugedacht wird, zeigen die Entwicklungen von Lernumgebungen im Internet.
Zusammenhänge schnell erfassen, Ideen formulieren, Methoden entwickeln, um Probleme zu lösen, und das in einer kurzen Zeit und als Teamleistung, sind einige der Kompetenzen, die unter Einbeziehung von PC und das Internet gefördert werden sollen.
Die Übergänge von der Kindheit zur Jugendzeit und zum Erwachsenensein sind fließend. Weil diese Grenzen heute nicht eindeutig definiert werden können, wird es zunehmend schwieriger, den genauen Übergang von der Kindheit in das Jugendalter festzusetzen. In diesem Sinne hat Neil Postman durchaus Recht, wenn er vom „Verschwinden der Kindheit“ spricht. Hinzu kommt, dass die Kinder durch die Medien mit Themen konfrontiert werden, die typisch für das Erwachsenensein (z. B. Sexualität) sind. Es wird damit für die Eltern immer schwieriger, ihre Kinder langsam auf diese Themen vorzubereiten.
Kinder wachsen in einer Mediengesellschaft auf. Was so lapidar klingt, vermittelt eine harte Botschaft, sich mehr oder weniger bedingungslos den Anforderungen der Leistungsgesellschaft stellen zu müssen. Die Familie wird in diesem Sinne zum „Erfüllungsgehilfen“ der technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Zu ihrem Nachteil gereicht es, dass sie die Rahmenbedingungen nicht steuern, sondern höchstens die Folgen abmildern kann.
So nutzen unsere Kinder Medien
Die heutige Elterngeneration erzieht ihre Kinder mehrheitlich in einem toleranten und freiheitlichen Klima, entsprechend groß sind die Freiheitsräume der Kinder. Das honorieren die Kinder und würden ihre eigenen Kinder später ähnlich erziehen, wie sie selbst erzogen wurden. Insgesamt lässt sich das Verhältnis der beiden Generationen zueinander als harmonisch bezeichnen.
Die gewonnenen Freiheitsgrade kommen den Kindern auch bei der Mediennutzung zugute. Während die heutige Kinder- und Jugendgeneration multimedial aufwächst, steigt die mediale Kluft zu den eigenen Eltern. Letztere sind nicht mit Internet, Handy und Co. aufgewachsen, lernten den Umgang mit dem Computer oft im Zuge ihrer Erwerbstätigkeit und kennen vielfach die neuen Medienentwicklungen nicht so gut wie ihre Kinder. Entsprechend schwierig ist es für sie abzuschätzen, welche Folgen die Medien für ihre Kinder haben könnten, und sie wissen nicht, mit welchen medialen Inhalten sich ihre Kinder auseinandersetzen. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, stelle ich in Auszügen die Ergebnisse der KIM-Studie 2006 (Kinder und Medien-Basisstudie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest, die regelmäßig seit 1999 den Stellenwert der Medien im Alltag der sechs- bis 13-Jährigen erhebt), dar.
Um das familiäre Umfeld berücksichtigen zu können, wurden die Kinder mündlich befragt und die Mütter mit einem Fragebogen einbezogen.
Die Kinder wachsen in einem multimedialen familiären Umfeld auf. In den Haushalten gibt es fast flächendeckend Fernseher, Telefon, Handy und Radio. 89 Prozent der Familien in Deutschland besitzen einen Computer, 81 Prozent einen Internetanschluss. Kassettenrekorder, Spielkonsole, Digitalkamera, Plattenspieler, MP3-Player gibt es in weit mehr als der Hälfte der Familien in Deutschland (vgl. KIM-Studie, 2006, S. 7).
Was die Medienausstattung anbelangt, verfügen Familien mit einem Nettoeinkommen von unter 1.500 Euro über deutlich weniger Geräte als Familien mit einem Nettoeinkommen von 2.500 Euro monatlich, ausgenommen ist hierbei der Fernseher (vgl. KIM-Studie, 2006, S. 8).
CD-Player, Kassettenrekorder und Radio sind die Geräte, die in den Kinderzimmern stehen, ebenso wie eine tragbare Spielkonsole, über die die Hälfte der Kinder verfügen kann. 44 Prozent der Kinder sind im Besitz eines eigenen Fernsehers, 36 Prozent können ein Handy ihr Eigen nennen und auch der MP3-Player ist zwar bei den Jungen etwas häufiger anzutreffen, gehört aber quasi zum Standardinventar.
Nicht ganz so weit verbreitet sind Computer und Internet, doch das wird sich in den nächsten Jahren sicher ändern.
Bereits 14 Prozent der Mädchen und 21 Prozent der Jungen besitzen einen eigenen Computer und 8 Prozent können im Kinderzimmer das Internet über den eigenen Internetanschluss entdecken.
Das Fernsehen steht mit 97 Prozent an erster Stelle der Freizeitaktivitäten, gefolgt von Freunde treffen (96 Prozent) und Hausaufgaben machen (95 Prozent). Hoch in der Gunst stehen aber auch „draußen und drinnen spielen“ sowie „etwas mit den Eltern oder der Familie unternehmen“.
Bei den Freizeitaktivitäten gibt es Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Erstere sitzen häufiger am Computer und spielen öfter Videospiele und sind zudem sportlich aktiver, demgegenüber mögen die Mädchen kreative Tätigkeiten, musizieren, lesen deutlich mehr Bücher und sind tierverliebter.
Die Idole der Kinder kommen aus Film und Fernsehen (z. B. Harry Potter), Sport (z. B. Michael Ballack) und dem Musikgeschäft (z. B. Robbie Williams).
Im Zuge der kindlichen Entwicklung verliert das Fernsehen etwas an Bedeutung (zu Gunsten des Computers), bleibt jedoch das wichtigste Medium.
Die Kinder haben ihre eigenen Vorlieben beim Fernsehen: Gerne sehen sie „Sponge Bob“, „GZSZ“ oder „Verliebt in Berlin“. Bei den Fernsehprogrammen sind Super RTL und KIKA die Lieblingssender, wodurch sich das Fernsehverhalten der Kinder von denen der Jugendlichen unterscheidet.
Der Kinderkanal ist bei Sechs- bis Siebenjährigen der Spitzenreiter, bei Acht- bis Neunjährigen ist es Super RTL und bei 10- bis 11-Jährigen liegen Super RTL und RTL gleichauf.
Neben dem Fernsehen hat das Musikhören in dieser Altersgruppe eine große Bedeutung. Bereits ein Drittel aller Kinder kann auf digitale Musikdateien zurückgreifen. Schon Sechs- bis Siebenjährige hören regelmäßig Radio, nach Einschätzung des „Haupterziehers“ ca. 41 Minuten täglich (vgl. KIM-Studie, 2006, S. 23).
Über Erfahrungen mit dem Computer verfügen knapp über 80 Prozent der Kinder und schon die Jüngeren (Sechs- bis Siebenjährigen) zählen zu den Computernutzern (57 Prozent). Anders als bei den Jugendlichen dominiert der Computer noch nicht den Tagesablauf der Sechs- bis 13-Jährigen, primär wird der Computer zu Hause genutzt, mit zunehmendem Alter auch in der Schule oder bei Freunden (vgl. KIM-Studie, 2006, S. 30). Gerade in dieser Altersgruppe sind die Eltern die Vorbilder ihrer Kinder, daher ist es nicht überraschend, wenn die Kinder in der Regel ihre Kenntnisse im Umgang mit dem Computer primär von ihren Vätern erhalten haben. Genutzt wird der Computer am Nachmittag, wobei es Regeln gibt, die die Kinder einhalten müssen, wenn sie ihn allein nutzen. Mit zunehmendem Alter nehmen die Restriktionen ab.
Zu den Lieblingsbeschäftigungen am Computer gehört das Spielen, 63 Prozent spielen allein, 52 Prozent mit Freunden zusammen. Beliebt sind auch Lernprogramme (43 Prozent) und Surfen im Internet (41 Prozent).
Bei der Nutzung des Computers gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede: Mädchen nutzen den Computer öfter zum Lernen und für die Schule, sie schreiben häufiger Texte oder malen am Computer. Jungen spielen dafür mehr und intensiver Computerspiele.
Den Eltern ist nicht egal, was ihre Kinder am Computer machen, 72 Prozent fragen nach und wollen wissen, welchen Tätigkeiten ihre Kinder nachgegangen sind (vgl. KIM-Studie, 2006, S. 33). Den „Konfliktfall Computer“ gibt es: Wenn Kinder ihn zu lange nutzen, wird seitens der Eltern Kritik laut.
Mit zunehmendem Alter wird das Internet für die Kinder interessanter und wichtiger. Nur eine kleine Gruppe von 14 Prozent ist jeden oder fast jeden Tag im Internet unterwegs, zum festen Bestandteil des Tagesablaufs ist das Internet bei der großen Mehrheit der Kinder noch nicht geworden.
Zwar wird immer wieder auf die Gefährdungen im Internet hingewiesen, dennoch ist ein Drittel der Sechs- bis 13-Jährigen allein im Netz unterwegs, bei 42 Prozent gibt es die gemeinsame Nutzung mit den Eltern (vgl. KIM-Studie, 2006, S. 43).
Was tun Kinder im Internet? Sie suchen in erster Linie nach Informationen, und zwar vorwiegend für die Schule und die sie interessierenden Themen. 40 Prozent aller Kinder spielen allein Onlinespiele, etwa 25 Prozent spielen gemeinsam mit anderen. Sie interessieren sich aber auch für speziell für sie entwickelte Onlineangebote, ein Drittel kann E-Mails empfangen und verschicken.
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede treten deutlich hervor: Mädchen suchen öfter als Jungen nach Informationen für die Schule, sind kommunikativer (Chatten, Instant Messanger). Jungen spielen mehr im Internet und laden häufiger Dateien aus dem Internet herunter.
Das Fernsehen nimmt in dieser Altersgruppe einen bedeutenden Stellenwert ein, vorwiegend, um die Langeweile zu vertreiben. Wenn Kinder über Alternativen verfügen (z. B. mit Freunden treffen), ziehen sie dies der Mediennutzung vor (vgl. KIM-Studie, 2006, S. 56).
Die Eltern als Vorbilder der Kinder verfügen über einen beträchtlichen Einfluss auf ihre Kinder, was sich eben auch auf die Mediennutzung auswirkt. Die höchsten Medienwerte bezüglich der Nutzungszeiten bei den Erwachsenen erhalten Radio (126 Minuten) und Fernsehen (150 Minuten).