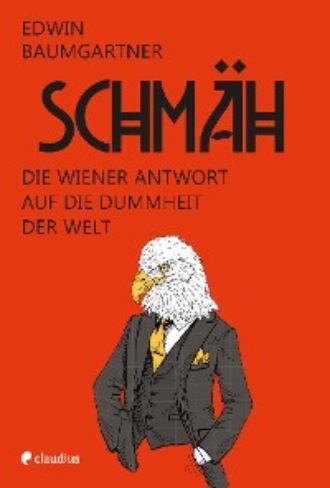
Полная версия
Schmäh
Und wenn der Schmäh ganz einfach eine ganz und gar wahre Geschichte ist, die der Erzähler nur durch seine Darstellung über Gebühr aufwertet? Auch das kann Schmäh bedeuten. Ich will es so versuchen: In diesem Fall macht der Erzähler aus einer Mücke einen Elefanten. Da aber Mücken keine Elefanten sind, diese Mücke aber für einen Elefanten ausgegeben wird, besteht in solch einer Maskierung die Abkehr von der Realität. Die US-amerikanische Dichterin Gertrude Stein hat zwar in Wahrheit geschrieben „Rose is a rose is a rose is a rose“, aber der Satz ist in sanfter Verballhornung längst auch in den deutschen Wortschatz eingegangen, wenn man sagen will: „Es ist, was es ist. Nicht mehr und nicht weniger.“ Demnach würde die Realität sagen: „Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“, während der Schmäh spräche: „Eine Rose ist ein Rosenstrauß ist ein Feld voller Rosen – darf ich Ihnen, schönste Frau der Welt, wenigstens eine davon schenken?“
Der Schmäh wäre also eine Geschichte oder Ausdrucksweise mit – sagen wir: speziellem Verhältnis zur Wahrheit. Als ob man damit den Schmäh eingrenzen könnte! Vielleicht lässt er sich ja bei seinem Namen packen: Schauen wir uns also an, woher die Bezeichnung kommt.
Wie bitte? Das Kapitel ist lang geworden? Richtig. Und so lange Kapitel sind nichts für die Lektüre in der Straßenbahn oder im Kaffeehaus? Nochmals richtig. Ich selbst ziehe ja kürzere Kapitel vor. Was es mit dem Wort Schmäh auf sich hat, steht daher erst im nächsten.
Da fällt mir gerade noch etwas ein – wird nicht lang, ich versprech’s, aber ich muss Ihnen noch etwas über die Frau Barischitz erzählen. Sie, die meine erste Begegnung mit dem Schmäh bewirkte, ist auch die Ursache dafür, dass ich bis heute kein Huhn esse. Der Schmäh kann halt ab und zu nach hinten losgehen. Bis zu jenem Tag meiner ferne zurückliegenden Kindheit habe ich Huhn leidenschaftlich gerne gegessen. An diesem bestimmten Tag ist meine Großmutter mit mir auf den Markt gegangen, um bei Frau Barischitz ein Henderl zu kaufen. Das sollte es, gebraten, als Mittagsessen geben. Meine Großmutter hat wirklich fabelhaft gekocht. Aus purer Vorfreude auf die resche Haut ist mir das Wasser im Mund zusammengelaufen. Meine Großmutter verlangt das Henderl und fragt ganz automatisch: „Is s eh frisch?“ Nun hätte Frau Barischitz einfach antworten können: „Ja.“ Aber eine einfache Ja-Nein-Antwort widerspricht allem, was Schmäh ist. So antwortete Frau Barischitz sozusagen stilecht: „Eh. Heunt’ in da Fruah hot s no Keandln pickt.“ Aus war’s. Nie wieder Huhn. Es war mir egal, ob das Huhn wirklich noch am Morgen Körner aufgepickt hat oder gestern Abend seine Henkersmahlzeit zu sich genommen hatte. Ich war kein völlig naives Kind. Ich meine: Instinktiv war mir durchaus klar, dass Kühe und Schweine das Schnitzelfleisch nicht freiwillig zur Verfügung stellen, und dass Brathühner kein Gemüse aus dem Glashaus sind. Aber die Vorstellung, dieses Tier zu essen, dass sich vor ein paar Stunden noch ein Korn nach dem anderen schmecken ließ und dabei glücklich war: Es war für mich so absolut unerträglich, dass ich nie wieder Huhn gegessen habe. Nicht als Kind – und irgendwie sitzt mir dieser Schock von damals noch immer so sehr in den Knochen, dass ich auch heute kein Huhn esse.
Schmähohne.
INTERMEZZO: IM MODEGESCHÄFT GEGENÜBER
Im kleinen Modegeschäft auf der anderen Seite der Straße, später Nachmittag.
- Griaß Sie, Frau Schuller.
- Griaß Sie, Frau Sladek. San S wieda gsund?
- Danke der Nachfrage, s woa jo nua a Schnupfn.
- God sei Daunk. Kaun i valleicht wos duan fia Sie?
- Schauma! Da Mantl, den S in da Auslag hom …
- Wöcha?
- Da graue min Bözgraugn – wos kost n dea?
- Regulea ochtfünf, owa fia Sie ocht, waun ma scho in gleichn Haus wohna.
- Des is ma aa zvüü. Fünfe?
- Na, do vadien I nix mea. Sie wissen eh: Außer Ihnan kriagt bei mia sunst kana an Rabatt. Owa fünfe kaun i wiaklech net mochn. Woatns, I hoe eana den Mauntl, dass amoe einaschlupfn kenna. So, no brobians amoe. Und jetzt schaun S in d n Spiagel. Sea fesch, sog i …!
- Eh. Und drogt si guat. Owa ocht is ma zvü.
- Da Graugn is a Oat Neaz! Haaßt Kolinski und kummt aus Russlaund.
- Schmähohne, von de Russn?
- Schmähohne. Griaß Sie, Frau Steputat.
- Grüß Sie, Frau Schuller. Ham Sie noch die Pelzjacke, die ich gestan probiat hab?
- An Momend, Frau Steputat, I bin glei bei eana. No, wos manan S, Frau Sladek?
- I waaß net. Fesch is a scho.
- Und ea steht Ihnan. I sogat’s net, wauns net woa warad. Grod, oes wa r a fia Sie gmocht.
- Ich bin ein bisserl in Eile, Frau Schuller …
- Glei, Frau Steputat. Dea foed guat. No, ka Wunda bei eanara Figua!
- Dank ihnan. Ea gfollad ma wiaklech guad.
- Schaun S eana de Vaoaweidung au. Sengen S, wia fein die Nähte san?
- Und dea is wiaklech aus Russlaund?
- Nua da Kragn. Da Rest is aus da eiganen Schneidarei.
- Drum …
- Ich hab noch ein paar Wege zu machen, könnten Sie mich vielleicht dazwischenschieben?
- An Momend, Frau Steputat, glei bin i bei eana!
- Die Jacke …
- An Momend, Frau Steputat.
- Fesch is a, sea sogoa. No jo … Wissen S wos? Lossen’s n herinn, i geh gschwind eikaufn und üwaleg dabei, ob i ma des leistn kau. Wiedaschaun, Frau Schuller.
- Wiederschaun, Frau Sladek. Gstopft wia r a Gansl, da Mau von ia, owa haundln wüü S. So, jetzt hol i de Jackn fia Sie, Frau Steputat.
- Aber neun is wirklich viel. Sieben, sonst kommen wir nicht ins Geschäft.
- So, da hamma de Jackn. Schlupfen S eine, Frau Steputat. Fesch san S, sea fesch! Achtfünf fia Sie, waun ma scho in söbn Haus wohnan. Außer Ihnan kriagt sunst kana an Rabatt bei mia.
- Schmähohne?
- Schmähohne.
WOHER DER SCHMÄH KOMMT
Das muss ich Ihnen jetzt erzählen:
Gerade hab’ ich Ihnen erklärt, dass man nicht genau definieren kann, was der Schmäh ist und dass sich seine Bedeutung, je nach Verwendung des Wortes, im Dreieck zwischen treffendem Ausspruch, launigem G’schichterl und Lüge bewegen kann und alle seine Erscheinungsformen höchstens in dem Punkt einer eigenwilligen Auffassung von Wahrheit auf einen etwas unsauberen kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Und jetzt soll ich im darauffolgenden Kapitel erklären, dass ich nicht weiß, woher das Wort kommt. Gar nicht darauf einzugehen, wäre indessen auch unseriös, oder?
Karten auf den Tisch, es ist wirklich so: Woher das Wort Schmäh kommt, weiß niemand. Es ist wie bei der Frage, was der Schmäh seinem Wesen nach ist: Vermutungen äußern viele, nur belegen kann sie keiner.
Fangen wir (wie sonst?) mit dem Wehle an. In seinem Buch „Sprechen Sie Wienerisch“ leitet er das Wort aus dem Jiddischen „schmaien“ ab, was seinerseits vom hebräischen „sch’ma“ abstammt, das an prominentester, nämlich erster Stelle im jüdischen Glaubensbekenntnis steht: „Höre, Israel, JHWH ist unser Gott, JHWH ist einer“ (5. Mose 6,4). Demgemäß heißt das jüdische Glaubensbekenntnis nach seinen ersten beiden Wörtern „Sch’ma Israel“. Wolfgang Teuschl gibt in seinem „Wiener Dialekt Lexikon“ dem Wehle recht, nicht expressis verbis zwar, aber auch er leitet den Schmäh von „schemá = Gehörtes“ ab.
Aber der Schmäh besitzt weder sonderliche religiöse Bindungen noch hat er mit Zuhören zu tun. Schmähführen ist vor allem Erzählen, sich unterhalten. Erzählen und Zuhören sind miteinander verbunden, aber das Eine ist nicht das Andere. Und zuhören kann man auch einer Musik oder dem Rauschen der Wellen oder dem Spiel des Herbstwindes in welkenden Blättern. Es bedarf beim Zuhören nicht unbedingt eines Erzählers. Zum Schmähführen jedoch gehört ein Erzähler. Wie sonst soll er denn sonst zu rennen anfangen, der Schmäh. Darum scheinen mir „schmaien“ und „Schmäh“ nicht ganz zusammenzupassen.
Andererseits gefällt mir der Hinweis auf das Jiddische. Der Schmäh und der jüdische Witz könnten wirklich Verwandte sein. Das fällt auf den ersten Blick nicht gleich auf, aber ich rede ja von einer Verwandtschaft über ein paar Ecken, fünf mindestens, und nicht von Zwillingen.
Für beide gilt nämlich das gleiche: Der Schmäh ist kein Witz, und der jüdische Witz ist kein Witz, wenn wir Witz so verstehen, wie das Wort heute als Synonym von Scherz gebraucht wird. Beide, sowohl der Schmäh als auch der jüdische Witz, besitzen indessen Witz, und zwar Witz im Sinn von Gewitztheit. Das maßgebliche Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm definiert das so: „WITZ, m. (f., n.), verstand, klugheit, kluger einfall, scherz“ und führt aus: „eine neue aufgabe fällt dem worte im 17. jh. zu, als das gesellschaftlich-literarische ideal des bel esprit, ,des aufgeweckten, artigen kopfes‘ aufkommt. witz wird unter einflusz des franz. esprit und des engl. wit bezeichnung für die gabe der sinnreichen und klugen einfälle. (…) vereinzelt schon im 18. jh., stärker mit dem beginnenden 19. jh., bedeutet witz den klugen einfall selbst, fast immer in scherzhaftem oder spöttischem sinne. gegen ende des jahrhunderts ist die bedeutung ‚scherz‘ im schriftsprachlichen gebrauch bereits so herrschend, dasz ältere verwendungen kaum noch sichtbar werden. die mundarten jedoch kennen auch heute noch witz als ratio, prudentia, (…) vernunft, verstand, klugheit, list.“
Zum Beispiel würde dieser jüdische Witz in minimaler Variation auch als Schmäh gewandet gute Figur machen: Grünzweig ist wieder einmal knapp bei Kasse. Er hofft, dass ihm Freiherr von Rothschild, der für seine Wohltätigkeit bekannt ist, aus der Geldverlegenheit hilft. Tatsächlich gelingt es Grünzweig, während einer Soiree zum Baron vorzustoßen. Als Grünzweig dann nach Hause kommt, fragt ihn seine Frau, wieviel ihm denn der Baron gegeben habe. „Fünf Gulden“, antwortet Grünzweig. „Fünf Gulden? Das ist alles?“ „Ach“, sagt Grünzweig, „es geht dem Baron selbst nicht gut im Moment. Er hat sogar ein Klavier verkaufen müssen.“ – „Wie kommst du auf diese Idee?“ – „Ich war doch bei der Soiree. Stell Dir vor: Zwei Pianisten hat er eingeladen, aber sie mussten gleichzeitig auf nur einem Klavier spielen.“
Diesen jüdischen Witz über ein missverstandenes Konzert eines Pianisten-Duos, das vierhändige Klavierstücke spielt, könnte man als Graf-Bobby-Witz maskieren: Graf Bobby hat im Badener Casino wieder einmal alles Bare verspielt. Da auch sein Freund, Baron Mucki, eben in Geldverlegenheit ist, setzt Graf Bobby seine Hoffnung auf den Freiherrn von Rothschild. Dann kann alles ablaufen wie im jüdischen Witz, nur tauschen wir am Schluss Frau Grünzweig gegen den Baron Mucki aus. Selbstverständlich erzählen wir die Geschichte nicht ganz gradlinig, sondern hängen sie an einer Bemerkung der Unterhaltung auf, die wir eben führen, und plustern sie ein wenig mit Nebensächlichkeiten auf (angesichts einer Soiree wird sich da unschwer etwas finden lassen). Andererseits sind die Zeiten eines Grafen Bobby schon lange vorbei. Für einen echten Schmäh wäre die Geschichte etwas zu aktualisieren. Sie kann ja einem Freund oder einem Bekannten passiert sein. In Ermangelung wohltätiger Superreicher, die obendrein Kunstmäzene sind, nennen wir keinen spezifischen Namen. Wir sagen einfach: Das war bei dem, na … Na, dem … Sie wissen schon … Fertig ist der Schmäh. Das nur zur Illustration, dass zwischen dem jüdischen Witz und dem Schmäh ein gewisses weitläufiges Verwandtschaftsverhältnis besteht.
Dennoch bleibe ich dabei: Die von dem Wehle vorgeschlagene Ableitung des Schmähs vom jiddischen „schmaien“ überzeugt mich nicht.
Aber da wären ja noch Robert Sedlaczeks Ableitungsversuche. Bei Sedlaczek bin ich fast versucht, von dem Sedlaczek zu reden, zumindest hat er sich den Volksadelstitel, also den bestimmten Artikel vor dem Nachnamen, redlich verdient mit seinen Nachforschungen über die österreichische Variante der deutschen Sprache. In seinem Buch „Das österreichische Deutsch. Wie wir uns von unserem großen Nachbarn unterscheiden“ schlägt Sedlaczek vor, den Schmäh aus dem rotwelschen „Schmee“ abzuleiten, was Gaunersprache, Lüge und feiner Witz bedeutet.
Das ist bestechend. Rotwelsch ist keine eigenständige Sprache, die durch Verschriftlichung genormt wäre, sondern ein Sprachamalgam, bestehend aus der Muttersprache fahrender Völker und des Mittel- und Frühneuhochdeutschen, also ein Dialekt oder Soziolekt. Als solcher wird Rotwelsch vor allem mit den Roma verbunden. Womit ich jetzt, quasi als Beleg für Sedlaczeks These, zum Lavendelschmäh komme.
Wo habe ich geschrieben, der Schmäh sei an politischer Korrektheit völlig desinteressiert? – Jetzt ist einer der Momente, an dem man um diese politische Unkorrektheit nicht herumkommt. Nur: Wie drück’ ich’s am unverfänglichsten aus? „Ganz direkt“, sagt die Lektorin meines Vertrauens, „die Schmähbriefe an dich leitet der Verlag sicher weiter.“
Jo, eh. Und danke für das Wortspiel mit den Schmähbriefen. Auf die Idee komme ich gleich zurück.
Zuerst aber die Sache mit dem Lavendelschmäh. In früheren Zeiten war es dem Wiener, und keineswegs nur ihm, völlig egal, wie sich Völker selbst nannten. Man hatte eigene Bezeichnungen für sie. In der Linguistik nennt man das, wenn einem Volk eine Benennung durch ein anderes Volk oder einen anderen Kulturkreis erfährt, eine Fremdbezeichnung. Solche Fremdbezeichnungen gelten heute als politisch unkorrekt. Wenn zum Beispiel Bayern alle nichtbayerischen Deutschen als „Preißn“ bezeichnen, Österreicher für diese das Wort „Piefke“ verwenden, die „Piefkes“ die Österreicher wiederum als „Schluchtenscheißer“ bezeichnen und so weiter, dann ist das zwar Folklore, über die zu lachen man sich mittlerweile (hoffentlich) auf allen Seiten durchgerungen hat, aber die Ausgangslage, um es so zu sagen, ist nicht die schmeichelhafteste.
Genau das ist nämlich der Haken mit diesen Fremdbezeichnungen: Sie sind in der Regel wenig liebevoll. Die Samen waren „Lappen“ (was in skandinavischen Sprachen, von denen wir das Wort auch in der Form „läppisch“ übernommen haben, soviel heißt wie „Deppen“), die Inuit waren „Eskimos“ (woher das Wort kommt, ist wie beim Schmäh: keiner kann’s genau bestimmen, „Rohfleischesser“ gilt mittlerweile als widerlegt) und Roma und Sinti waren „Zigeuner“.
Jetzt zum Lavendelschmäh – und ich warne vor, ich bleibe politisch unkorrekt, nicht aus freien Stücken, sondern weil’s anders nicht geht.
Die tief-lila leuchtenden Blüten des Lavendelstrauchs wurden in alter Zeit getrocknet und, zu kleinen Sträußen gebunden, verkauft. Ich kann mich gut erinnern, dass meine Großmutter immer ein Sträußchen duftenden Lavendels in den Wäschekasten legte, und wenn ich bei ihr übernachtete, roch die Bettwäsche nach Lavendel. Lavendel galt nicht nur als natürlicher Wäscheduft, man sagte ihm auch nach, Kleidermotten abzuwehren. Für manche Mottenarten stimmt das tatsächlich, andere dürften geruchstaub sein.
Die Lavendelsträußchen wurden im Sommer auf der Gasse von den Lavendelweibern angeboten mit dem gesungenen Ruf: „An Lawendl hama do. Wer kauft uns an o?“ Das greinende Lied der Lavendelweiber gehörte zu Wien, wie die Lieder und Rufe der Gondolieri zu Venedig gehören. Heute sind die Lavendelweiber verschwunden. Dem wahrscheinlich letzten begegnete ich vor etwa fünfzehn Jahren in der Wollzeile, einer Straße, die sich nahe dem Stephansdom befindet. Es war eine uralte Frau, klein, gebückt, mit faltenzerfurchtem Gesicht, schlicht gekleidet, nur das Kopftuch war auf bäuerische Weise bunt. Zum Singen reichte die Stimme nicht, der Lavendelruf kam nur angedeutet über die Lippen – aber es war der alte Lavendelruf. Ich habe ihr ein Sträußchen abgekauft. Längst habe ich vergessen, wieviel mich das kostete. Ein Vermögen war es nicht. Das Lavendelsträußchen erfrischte meine Wäsche wochenlang auf betörende Weise. Außerdem hatte ich das Lied von einem echten Lavendelweib vorgetragen gehört. Das war’s wert.
In älteren Wiener Tagen waren diese Lavendelweiber meist Zigeunerinnen. Selbstverständlich war auch damals der Verkauf von Lavendelsträußchen ein hartes Brot. So besserten sie ihr Einkommen mit dem auf, was man Zigeunerinnen ohnedies als besondere Gabe nachsagt: Sie lasen aus der Hand. Naturgemäß erfreuen gute Nachrichten eher als schlechte und öffneten somit ein wenig weiter die Geldbörse der Kundschaft. Das wiederum ließ die handlesenden Lavendelweiber eine gewisse sanft vertrauliche, sagen wir’s rundheraus: schmierige Art annehmen, sowohl beim Anbieten als beim Ausüben der Wahrsagerei. Somit ist der Lavendelschmäh die schmierige Variante des Charmes, und „waun bei ana a jeda Lawendlschmäh einegeht“8, dann bedeutet das die allzu leichte Verführbarkeit einer Frau – wozu auch immer. Männer mit schmierigem Charme haben’s manchmal halt leicht.
Der Lavendelschmäh bindet den Schmäh also an Roma und Sinti an und könnte ursprünglich der rotwelsche Schmee gewesen sein. Doch in seinem „Wörterbuch des Wienerischen“ schlägt Sedlaczek noch eine andere Herkunftsvariante des Wortes vor. Er leitet es vom Mittelhochdeutschen smæhe ab, was „schmähen“ in der heute üblichen Bedeutung von verächtlich machen, beschimpfen bedeutet. Damit hat zwar der Schmäh nichts zu tun, aber Sedlaczek meint, es könne „allmählich zu einer Verbesserung in der Bedeutung gekommen“ sein.
Ganz folgen kann ich dieser Ableitung nicht. Einerseits, weil ich der Bedeutungsverbesserung misstraue und mich frage, wo die denn hergekommen sein soll, andererseits, weil eine Schmähung rein inhaltlich mit dem Schmäh nichts zu tun hat.
Oder doch?
Eine echte Schmähung besteht nicht darin, jemandem ein Schimpfwort an den Kopf zu werfen, sondern sie ist eine Schmährede, also eine mehr oder minder ausführliche Geschichte über den so Geschmähten. In dieser Geschichte mag nun manches nicht stimmen und etliches übertrieben sein. Lässt man den absichtlich schlecht machenden Inhalt weg – dann würde das recht gut passen zum besonderen Verhältnis des Schmähs zur Wahrheit.
Eine Freundin hat mir unterdessen noch eine Variante vorgeschlagen, die sogar ein paar Schritte weit in die Richtung der Bedeutungsverbesserung Sedlaczeks geht. Sie meint, der Schmäh sei das G’schichterl gewesen, das die Schmähung verwässert und dadurch für den Geschmähten und sein Umfeld erträglich gemacht hat. Die Erzählweise passt da eigentlich recht gut dazu.
Oder sollte der Schmäh gar nicht selbst schmähen, sondern geschmäht werden, weil er eine Lügengeschichte ist oder eine auf unseriöse Art erzählte Begebenheit, eine aufgeplusterte Belanglosigkeit? Könnte auch sein.
Übrigens kennt der Schmäh zwei weitere Varianten. Beide sind ein bisserl konkreter. Der Ansaschmäh ist der Schmäh, der einem in irgendeiner Situation sozusagen naturgemäß einfällt. Da preist beispielsweise ein Altwarenhändler ein paar morsche Sessel, die unter dem Gewicht eines Palmers-Unterwäschemodels zusammenbrächen, als „wirklich antik“ an und bittet, etwas zurückzutreten, weil die perfekte Formgebung der Sitzmöbel nur aus größerem Abstand zu erkennen sei, was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass man im Halbdunkel des Kellergewölbes die Wurmlöcher nicht sieht. Sofern der Kunde Wiener ist, wird er zu dem Händler sagen: „Net kumman S ma mi n Ansaschmäh.“ Der Ansaschmäh ist demnach ein simpler Schmäh, der leicht durchschaubar ist.
Eng verwandt mit ihm ist der Safaladischmäh. In Safaladi steckt das italienische cervello für Hirn. Denn aus dem cervello machte man seinerzeit die Cervellata, eine billige Wurst aus Innereien, zu denen auch das Hirn gehörte. Die Wurst existiert noch heute in ihrer kalabrischen, Mailänder und apulischen Variante, wenngleich mit anderen Ingredienzen. Die Zervelatwurst soll mit ihr verwandt sein. Einige Quellen behaupten auch, die Bezeichnung ginge auf cervo, Italienisch für Hirsch, zurück; ob Wildingredienzen in der Wurst waren, oder ob sie wie Wild gewürzt wurde, da gehen die Interpretationen auseinander. Jedenfalls war die Cervellata seinerzeit eine billige Wurst. Der Wiener Dialekt benützte den Ausdruck Safaladi für etwas Minderwertiges und Verlogenes, so, wie die Wurst eigentlich billig war, aber durch Gewürze in der Qualität aufgewertet schien. Ein Safaladibruada ist ein Mensch, der kein Vertrauen verdient, und der Safaladischmäh ist ein billiger Schmäh, der sofort als Lüge zu durchschauen ist.
Apropos Wurst, weil wir gerade bei dem Thema sind: „Mir ist das gleichgültig“ heißt im Wiener Dialekt „des is ma wuascht.“ „Wuascht“ ist „Wurst“, und die Wurst ist der große Gleichmacher unter den Fleischwaren. Sehen Sie, das ist typisch Schmäh: Aus „gleichgültig“ macht er „gleich“, „gleich“ assoziiert er mit „alles gleich gemacht“ und „alles gleich gemacht“ mit der Wurst. Und warum dies? Nun: Um wieviel bildkräftiger ist eine Wurst als das abstrakte „gleichgültig“? Je bildkräftiger, desto schmähfreudiger.
Nur, bitte, eine vegetarische Wurst sollte es nicht sein, und schon gar nicht bei einem Würstelstand. Den Versuch hat es gegeben, und zwar auf dem Wallensteinplatz im 20. Wiener Gemeindebezirk. Nun ist die Wurst aber dem Wiener heilig. Es kommt nicht von ungefähr, dass der Artmann seine Sammlung von Wiener Feuilletons „Im Schatten der Burenwurst“ betitelte. Der vegetarische Würstelstand wurde feierlich eröffnet. Am Anfang war er gut besucht, der vegetarische Würstelstand, so ein, zwei Wochen lang. Weil man’s halt kosten wollte. War eigentlich gar nicht übel, wie ich im Selbstversuch erfuhr. Aber dem Wiener macht man kein wurstförmiges Trumm Seitan für eine Burenwurst vor, und ohne die „Eitrige“, also die Käsekrainer, geht sowieso gar nichts. Schließlich war der Strom der Kunden ausgedünnt: Hin und wieder strömte halt ein Kunde vorbei. Dann wurde der Würstelstand längere Zeit renoviert, vielleicht, um den Wiener vergessen zu lassen, welcher besonderen Art diese Würstel waren. Jetzt verkauft der Würstelstand wieder Würstel aus echtem Fleisch.
Den Würstelstand ist dem Wiener sowieso heilig, so quasi ein Wurstdom ist er ihm, und die Einnahme des Feilgebotenen gleichsam eine Handlung des Glaubens. In der Umgebung eines Würstelstands geschehen demnach auch Wunder. Zum Beispiel eines des Geruchs. Wer immer von den höheren Mächten über die Wiener Würstelstände wacht: Er hat beschlossen, einen der besten ans Eck von Tuchlauben und Hohem Markt im Ersten Wiener Gemeindebezirk zu stellen. Die Kreuzung ist durch eine Ampel geregelt, die den Verkehrsteilnehmern in regelmäßigen Abständen Wartezeiten auferlegt. Zu den Verkehrsteilnehmern gehören daselbst, neben Fußgängern, Radfahrern, Autos und Autobussen, auch Fiaker, also die speziell bei Wien-Touristen beliebten Pferdekutschen. Weshalb die Pferde ausgerechnet diesen Ort erwählt haben, um mit breitem Strahl zu urinieren, weiß ich nicht. Aber es ist so. Diese Stelle ist ein Pferde-Pissoir. Dementsprechend riecht sie, speziell an heißen Tagen. Aufgrund dessen sollte man annehmen, dass der geruchsnahe Würstelstand unter dem betäubenden Duft leidet. Aber nun geschieht das Wiener Würstelstandgeruchswunder: Dieses lässt die Kunden des Würstelstands über den Pferdegeruch hinwegschnuppern, und was in die Nase steigt, ist nicht Pferd, sondern Bratgeruch von Burenwurst und Käsekrainer. Zu manchen Tageszeiten muss man sich anstellen, um zur Wurst zu kommen. Dann erlebt man es selbst, das Würstelstandsgeruchswunder, wenn man, aus dem Pferdegruch kommend, langsam eintaucht in den Duft der Wurst, zuerst noch in befremdlicher Mischung, dann verliert sich das Pferd, je näher man dem Würstelstand kommt, immer mehr und schließlich ganz, und man riecht nur noch die Wurst. Was könnte appetitanregender sein?
Bin ich jetzt wirklich von der Herkunft des Wortes Schmäh auf die Wurst gekommen? – Ja, so kann’s gehen beim Schmähführen. Beim einen beginnt man, beim ganz anderen landet man, und der rote Faden dazwischen sind nur die Untiefen der Wiener Seele.
Was ich selbst nun zur Herkunft des Wortes Schmäh meine? Klingt feig, aber ich kann mich nicht festlegen. Die Herkunft aus dem Rotwelsch scheint mir nächstliegend. Die aus dem Jiddischen hätte Charme, denn das Wienerische hat zahlreiche jiddische Wörter aufgesogen, „Haberer“ etwa, „Hawara“ gesprochen (und uns durch den Hinweis auf Teuschls „Da Jesus und seine Hawara“ ein Begriff) ist ein jiddisches Wort für Kumpel und gehört zum Standardwortschatz des Wieners, etwa, wenn er sagt: „I hob mi mid meine Hawara üwa d’ Heisa ghaut.“ Die mittelhochdeutsche Variante ist zumindest argumentierbar. Muss man sich immer festlegen?
Natürlich geht man als Wiener irgendwann einmal auf die Suche in der Hoffnung, etwas ganz Klares, völlig Eindeutiges zur ur-wiener Art der Kommunikation, was sage ich: der ur-wiener Haltung zu finden. Aber ich gebe zu, ich bin auf nichts Besseres gestoßen als der Wehle und der Sedlaczek. Meine Suche konzentrierte sich auf Sprachen, die in den Ländern der Donaumonarchie gesprochen wurden und die Wörter enthalten, aus denen, in Verballhornung, der Schmäh hätte werden können.

